Erstellt am: 6. 9. 2016 - 17:31 Uhr
Aus der Zeit gefallen
Reinhard Kaiser-Mühleckers Auftreten sieht nicht unbedingt wie das eines typischen 33-Jährigen aus. Statt mit T-Shirt und Jeans präsentiert er sich lieber in Hemd und Sakko. Doch auch seine Vita ist nicht die eines typischen 33-Jährigen. Bereits 2009, mit 25, hat er seinen ersten großen Roman veröffentlicht, "Der lange Gang über die Stationen", und seither hat er fünf weitere Romane und einen Erzählband geschrieben, die ihm teils hymische Rezensionen eingebracht haben.
Auf seinem gerade erschienenen Roman "Fremde Seele, dunkler Wald" etwa prangen hymnische Zitate von Paul Jandl ("Der Autor, der seine Bücher ins Zeitlose meißelt"), Siegfried Lenz ("Es ist wunderbar, wie Sie schreiben"), und Peter Handke ("Zwischen Stifter und Hamsun sind Sie ein Dritter") und er steht sowohl auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2016 als auch des neu ins Leben gerufenen Österreichischen Buchpreises. Doch gerade in "Fremde Seele, dunkler Wald" hat die "Zeitlosigkeit", die Kaiser-Mühleckers Literatur und Stil attestiert wird, einen faden Beigeschmack.
Nichts los in der oberösterreichischen Provinz
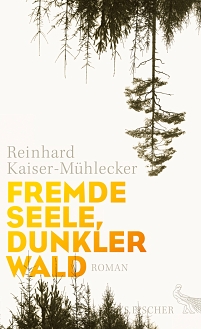
S. Fischer Verlag
In "Fremde Seele, dunkler Wald" erzählt Kaiser-Mühlecker die Geschichten von zwei Brüdern, Alexander und Jakob, die auf demselben Bauernhof im oberösterreichischen Hausruckviertel aufwachsen, allerdings verschiedene Abzweigungen im Leben nehmen. Alexander, der ältere, verlässt früh den Ort. Via Stiftsgymnasium und Philosophiestudium landet er beim Bundesheer und als UNO-Offizier im Kosovo. Jakob hingegen, der jüngere Bruder, ist mit dem Hof verwurzelt. Er ist Liebkind des Familienpatriarchen, des Großvaters mit Nazivergangenheit, ist mit ganzer Seele Bauer und soll auch einmal den Hof erben. Die Landwirtschaft führt der Teenager Jakob ohnehin schon, weil sein Vater lieber den Besitz mit irrwitzigen Geschäftsideen verspekuliert.
Weggehen als einziger Ausweg
Viel gibt's nicht zu tun für Alexander, wenn er auf Besuch in die oberösterreichische Provinz kommt. Sich zuschütten im Wirtshaus ist Alltagsbeschäftigung, ein Besuch der Landwirtschaftsmesse in Wels stellt schon ein Highlight dar. Da verwundert es kaum, dass er sich schnell wieder aus dem Staub macht und sich im Kosovo oder in Wien in Affären stürzt. Jakob hingegen wird im Laufe des Romans aus der Nische, in der er es sich eingerichtet hat, vertrieben. Seine Freundin, die er nicht liebt, wird schwanger. Aus Pflichtbewusstsein zieht er mit ihr in eine eigene Wohnung und nimmt einen Hilfsarbeiter-Job beim Maschinenring an, um die junge Familie zu erhalten. Dass das nicht gut gehen kann, ist absehbar. Nach und nach zerplatzen seine Lebensträume und obendrauf wird er von der Dorfgemeinschaft ausgestoßen.
Den Stoff, den Reinhard Kaiser-Mühlecker wählt, kennt man schon in weitaus besserer Qualität aus der Anti-Heimatliteratur aus den 1970er Jahren, Jakobs Schicksal erinnert etwa stark an Gernot Wolfgrubers "Herrenjahre" aus dem Jahr 1976. Dass sich seither am Land nicht wirklich etwas geändert hat, kann man sich kaum vorstellen, doch in Kaiser-Mühleckers Schilderungen hat die Gegenwart hier nicht Einzug gehalten. 2016 wird zwar über den Ukraine-Konflikt diskutiert, doch niemand jagt nach Pokémons oder checkt Social-Media-Timelines.
Antiquierte, künstliche Sprache
Doch es ist nicht nur der Rahmen, der wenig Authentizität ausstrahlt, es ist vor allem die Sprache, die der Autor für seine ProtagonistInnen wählt, und die weder ins Hausruckviertel noch in unsere Zeit passt. Sie changiert zwischen schwurbeligen Theatermonologen und platten Bauernweisheiten, die allerdings in die Hochsprache transkribiert völlig fehl am Platz wirken. So träumt eine der Figuren etwa davon, sich von einer älteren Frau verführen zu lassen, denn "[i]hr wisst ja, auf den alten Rädern lernt man das Fahren." Jakob wiederum "mutmaßt" erstaunlich oft, z.B. dass er seine Freundin Nina "niemals begehren" würde, weil ihm die "Fähigkeit zu wirklicher Leidenschaft" fehle. Und Alexander will sich nach einer unglücklichen Liebschaft wieder etwas Neues suchen, denn "[a]uch andere Mütter hatten schöne Töchter."
Besonders peinlich wird’s, wenn Kaiser-Mühlecker Alexander mit seinem neuen „Tabletcomputer“ online gehen lässt, wo er "die Entdeckung [macht], dass sich das Internet, das er bis dahin nur beruflich, zum Versenden von E-Mails und sporadisch für das Bestellen von vergriffenen Büchern verwendet hatte, hervorragend dazu eignete, Zeit totzuschlagen." Vom vielen sinnlosen Surfen bekommt Alexander sogar Gewissensbisse.
Während Autoren wie Clemens Setz versuchen, eine literarische Sprache zu finden, die unserer Zeit angemessen ist, zieht sich Kaiser-Mühlecker verweigernd zurück. Im Interview mit Mari Lang hat Reinhard Kaiser-Mühlecker bereits 2008 gemeint, er würde sich bemühen, sprachlich nicht als Antiquitätenmeister abgestempelt zu werden, dass er sprachlich bereits in der Moderne angekommen wäre und nicht vor hätte, sich an der Stadt-Land-Thematik abzuarbeiten. Anscheinend hat er es sich aber wieder anders überlegt.
Beim Lesen von "Fremde Seele, dunkler Wald" muss man sich jedenfalls andauernd entweder über abgestandene Phrasen, Landklischees oder umständliches Geschwurbel ärgern, die passiven Frauenfiguren in Kaiser-Mühleckers Roman wären einen eigenen Artikel wert. Und auch der Inhalt reißt den Roman nicht mehr raus. Erzählstränge mit Potential, wie die von einem geheimnisvollen Mord, einer Sekte von Urchristen oder dem geheimnisvollen Ursprung des Großbaters Reichtum verlaufen sich. Alles zusammen ist das sehr unbefriedigend, noch dazu für einen Roman, der für große Buchpreise nominiert ist.


