Erstellt am: 14. 7. 2016 - 14:42 Uhr
Die Revolution frisst ihre Eltern
Kurdistan muss erst einmal verortet werden. So einfach ist es nicht mit diesem Land, das als autonome Region im Nordirak geführt wird. Hierzulande ist es die Filmemacherin Kurdwin Ayub, die mit ihrer sehr familiären Dokumentation "Paradies! Paradies!" in die Stadt Erbil in Kurdistan-Irak führt. Und unter den literarischen Neuerscheinungen findet sich "Der letzte Granatapfel" von Bachtyar Ali.
Und Bachtyar Ali blendet zurück. In seinem Heimatland zählt er zu den bedeutendsten Dichtern, seit Mitte der 1990er lebt der heute Fünfzigjährige in Deutschland. Mit "Der letzte Granatapfel" ist erstmals einer seiner Romane in deutscher Sprache erhältlich und die Welt, die sich darin eröffnet, ist eine sehr fremde.
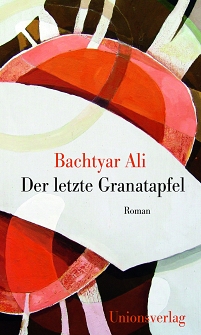
Unionsverlag
"Als sie mich aus dem Wagen geholt hatten, roch es nach frühem Morgen. An jedem Ort hat das Erdreich im Morgengrauen einen besonderen Geruch. Nach einundzwanzig Jahren im Sandmeer hatte sich mein Land in eine Illusion verwandelt."
Was wie eine Folge von "Homeland" beginnt, wird eine Geschichte voll fantastischer Bilder. Märchenhaft schreibt Bachtyar, als dränge das Grauen von Bürgerkriegen die Geschichte in poetische Ebenen, um das Leben erträglich zu machen. Einundzwanzig Jahre lang ist der Ich-Erzähler in Gefangenschaft in der Wüste. Nach einer plötzlichen Überstellung in einen Palast gelingt der Geisel die Flucht. Die Wüste war ihm zur Heimat geworden. Die Schilderungen des Sandes lullen einen ein, auch als LeserIn möchte man nicht so schnell fort, aber ein Stillstand ist nicht vorgesehen. Die Sehnsucht, seinen Sohn wiederzufinden, treibt den Mann an. Aber den Sohn hat er zuletzt als Baby gesehen. Dann tun sich auch noch Namensübereinstimmungen auf:
"Ich war bestürzt und verwirrt, viel mehr als während meiner Suche nach dem zweiten Saryasi. Wie konnte mein Saryasi sich so seltsam aufspalten? Würde ich dieses Puzzle je zusammenführen können?“
Was dem Roman fehlt, ist ein Anhang mit einem kurzen Abriss der jüngeren Geschichte Kurdistans. "Der letzte Granatapfel" beginne "bei den Aufständen gegen Saddam Hussein, die dieser in den Achtzigerjahren auch unter Einsatz von Giftgas niederschlug" und reiche "bis zum innerkurdischen Bürgerkrieg nach der Autonomie in den Neunzigern", schreibt ein kundiger Kritiker. Das erschließt sich nicht beim Lesen.
Genau so geht es einem beim Lesen. Wie hängen all diese Leben und Erzählstränge zusammen? Aber bald ist einem das komplett egal, denn sehr bald treten Figuren auf den Plan, die ins Reich des Fantastischen führen könnten. Die singenden "Weißen Schwestern" etwa und ein Mann namens Mohamadi Glasherz, der stets einen gläsernen Granatapfel bei sich trägt. Sie trügen Geheimnisse mit sich, gibt der Erzähler preis. Mit jedem Umblättern einer Seite lernt man den märchenhaften Zugang Bachtyar Alis mehr zu schätzen. Realistisch geschildert, wäre der Inhalt nicht auszuhalten.
Als wäre Bachtyar Ali mit seinem Ich-Erzähler aus der Vergangenheit in die Gegenwart katapultiert worden und hätte die Bodenhaftung zur Realität noch nicht wieder gewonnen, erzählt er von historischen Gegebenheiten, die nie explizit erläutert werden. So ist niemand nur einfach ein illegaler Verkäufer auf einem Markt oder ein bettelndes Waisenkind.

Unionsverlag
Bachyar Ali plädiert für Menschlichkeit. Berührend ist das Treffen mit dem dritten Saryasi, den der Ich-Erzähler in einem Heim für behinderte Kinder antrifft:
"Dieser Junge, dessen Leib im Feuer verdorrt war, der nach all den dunklen Zimmern und der schwarzen Gewalt roch, in der er aufgewachsen war, war mein Sohn. Dies war der Augenblick, den ich mir einundzwanzig Jahre in der Wüste ausgemalt hatte."
Das von Bomben verstümmelte Kind wird von der Gesellschaft als Zumutung empfunden. Ein Geheimnis kann verraten werden: Schlussendlich handelt "Das Geheimnis des Granatapfels" von der Welt vergessenen Kindern. Klingt furchtbar, ist aber eine gute Lesereise.

