Erstellt am: 8. 5. 2016 - 13:38 Uhr
Vom neuen Zauberlehrling
Prag um 1900. Laibl Goldenhirsch, ein bescheidener, schriftgelehrter Rabbiner, hat nur einen großen Wunsch:
"Etwas fehlte in seinem Leben: ein Sohn. Er brachte zahllose Stunden damit zu, die Söhne anderer zu erziehen - Idioten, allesamt - und wann immer er in ihre Gesichter blickte, stellte er sich vor, eines Tages in das Antlitz seines eigenen Kindes schauen zu dürfen."
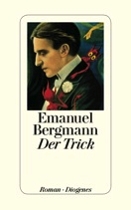
Diogenes
Der Trick ist im Diogenes Verlag erschienen.
Juhu, schließlich sollte es doch funktionieren. Laibl wird Vater. Sein Sohn ist ein schwächliches, verschlossenes Kind - das auch noch eine für Laibl abstruse berufliche Laufbahn einschlagen will.
"Wir sind hier beim Zirkus. Wir sind alle gleich. Im Theater ist jeder ein Edelmann."
Sehr gut, denkt sich der 15-jährige Mosche Goldenhirsch. Wie gesagt, ist er wie sein Vater Jude - und das in einer Zeit, in der dies gefährlich war. Wir schreiben das Jahr 1934, Mosche ist gerade von zuhause weg gelaufen, um sich dem Zirkus des Halbmondmanns anzuschließen. Er verliebt sich, als Draufgabe, in die schöne Assistentin desselben, in Julia. Bei den beiden wird er auf einer lustig-verqueren Irrfahrt lernen, Illusion und Täuschung auch im Rahmen politischer Propaganda, in seinem besonderen Fall zur Ablenkung der Nazis, einzusetzen. Für immer kann er jedoch nicht fliehen.
Bitte, ein Liebeszauber
Jahre später setzt der zweite Erzählstrang des Romans "Der Trick" ein. Wir lernen Max kennen, einen zehnjährigen Jungen, der furchtbar unglücklich ist. Seine größte Angst? Die Scheidung seiner Eltern. Sie sind gerade dabei, den Haushalt aufzulösen, die Mama "kann nicht mehr", Papa sieht sich hilflos, das Kind wird dann eben zwischen Wochentag und Wochenende aufgeteilt.
Da macht Max einen - für ihn großartigen - Fund:
"Max fühlte sich wie ein Archäologe, der den verschollenen Schatz einer längst untergegangenen Zivilisation entdeckt hatte. Mit zitternden Händen zog er die schwarze Platte aus der Hülle. Der Titel stand in großen, gelben Buchstaben in der Mitte der Scheibe: 'Zabbatini: Seine größten Tricks'."
Für Max steht fest: Er muss diesen Zauberer finden. Er braucht einen Liebeszauber für seine Eltern.
Kapitelweise abwechselnd aus der Sicht der beiden Protagonisten Mosche und Max erzählt, wird schnell klar, wer dieser große Zauberer ist, der auf der schon eher schäbig-abgenutzten Schallplatte vertreten ist: natürlich Mosche Goldenhirsch, besser bekannt als der Große Zabbatini.
Max findet ihn.
"Der Mann stöhnte. Er musste weit über achtzig sein. Sein Kopf war fast kahl, er hatte Hängebacken, buschige Augenbrauen, eine Knollennase. Ein trauriges Gesicht, gezeichnet von Jahren der Enttäuschung. Er trug ein verblasstes Hawaiihemd und ein Goldkettchen um den Hals, mit einem kleinen Davidstern dran."
... und auch ein bisschen Alltags-Magie bitte
Emanuel Bergmann spielt einfühlsam und wortwitzig den Ball zwischen dem alten, zynisch-verbitterten Magier und dem jungen, naiven Max hin und her. Erst nach und nach entwickelt sich eine zuerst schüchterne, dann immer intensivere Beziehung zwischen den beiden. Der aufgrund zu vieler Erfahrungen - vor allem vor dem Hintergrund des Nazi-Regimes - abgestumpfte Magier beginnt noch einmal, seine misanthropische Einstellung zu überdenken.
"In diesem Moment empfand Zabbatini ein unangehmes, ganz und gar ungewohntes Gefühl: Er war gerührt. Dem alten Zauberer, der fast sein ganzes Leben auf der Bühne gestanden hatte, fiel es schwer zu glauben, dass es Menschen gab, die das, was sie sagten, auch meinten."

Marina Maisel
Emanuel Bergmann, geboren 1972 in Saarbrücken, mittlerweile wohnhaft in LA, veröffentlicht mit "Der Trick" seinen Debütroman. Was in groben Zügen zuerst wie eine naive Kindergeschichte klingt, ist ein wunderbar scharfzüngiger, witziger Roman geworden, der eine lockere, aber keine naive Heiterkeit vermittelt. Seine Figuren sind düstere Grantler, missgünstige Doppelzüngler, naive Träumer. Dass sich Emanuel Bergmann bis jetzt hauptsächlich mit dem Verfassen von Drehbüchern beschäftigt hat, kommt der bildmalerischen Sprache seines Debütromans mehr als nur zugute.
Zwischen Schmäh und Ernst
Das schönste an der Sprache des Romans ist aber neben der fast schon cineastischen Inszenierung die gezielte Parodie, die im selben Moment zu bedachter Einfühlsamkeit umschwenken kann: zum Beispiel wenn Max seine Oma besucht, die den Holocaust überlebt hat und mittlerweile zu einer Hipster-Grandma mutiert ist, auf die Fran Fine neidisch wäre:
"Doch Opas Tod hatte Omchen stark verändert. Sie kaufte sich eine neue, goldgeränderte Brille, färbte sich ihr hochgestecktes Haar blau und fing an, grellbunte Jogginganzüge zu tragen, obwohl sie niemals joggte. Sie machte einen mexikanischen Kochkurs und zwang ihrer Familie kulinarische Experimente wie Tofu-Tamales und koschere Enchiladas auf."
(...)
"Sie erwiderte nichts. Max griff nach ihrer Hand, und obwohl sie nur einen Meter weit weg war, schien es, als sei sie in einer ganz anderen Welt. Er verstand, dass alte Menschen Wunden hatten, die man nicht sah."
Obwohl der Autor bewusst zwischen den Zeilen seiner schwarzen Komödie die Schrecken des Holocaust durchschimmern lässt, bewegt er sich gekonnt und sprachsensibel auf denkbar dünnem Eis. Ein Roman, der nicht vorgibt, Zeitgeschichte zu unterrichten oder moralisch das Rohrstäbchen zu zücken.
Hase aus dem Hut, Frau zersägt, Vorhang zu, Applaus, Applaus. Der Trick dabei: Ab und an die Magie glauben. Auch, wenn man es vielleicht besser weiß.


