Erstellt am: 7. 10. 2015 - 12:35 Uhr
American Psychosis
Er ist der große Unbekannte der amerikanischen zeitgenössischen Literaturszene: Nur, dass Donald Antrim Autoren wie Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides oder Richard Ford auf die Schulter klopfen.
Die drei vollendeten Romane von Donald Antrim - „Wählt Mr. Robinson für eine bessere Welt“ (1993), „The Hundred Brothers“ (1997), „Der Wahrheitsfinder“ (2000) – sind mittlerweile schon zum zweiten Mal erschienen. Acht Jahre sind vergangen, seit er sein Memoir „Mutter“ veröffentlicht hat. In diesen acht Jahren, erzählt Antrim, erlitt er einen völligen psychischen Zusammenbruch – und das zweimal. Während dieser Zeit war es ihm beinahe unmöglich zu lesen, geschweige denn zu schreiben. Die Buchstaben hätten einfach keinen Sinn ergeben. Weil es aber irgendwie doch sein Job ist, Geschichten zu schreiben, hat er sich, so oft es ging, trotzdem dazu durchgerungen. Und obwohl er sich nicht einmal mehr an alle Details erinnern kann, weil manche Wochen und Monate wie aus seinem Gedächtnis verschwunden sind, sieht er diese Geschichten als wichtiges Zeugnis seiner Erfahrungen.
Mehr Buchtipps - für unter, neben oder auch ganz ohne Christbaum - gibt's auf fm4.orf.at/buch

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Die sieben Kurzgeschichten sind vorab im Magazin The New Yorker publiziert worden.
Scotch? Oder doch lieber Scotch?
In jeder der sieben Stories trifft man auf einen männlichen Protagonisten, der wie ein Gummiball zwischen Selbstüberschätzung und Selbstzweifeln hin- und herspringt. Und sich- je nachdem - für Scotch, Dope, Lithium, Valium, Betablocker oder doch lieber Elektroschocks im Kampf gegen die Krise entscheidet. Ob Stephen oder Christopher, Billy oder Jim – viele Unterschiede gibt es zwischen den Charakteren nicht.
Eine Leseprobe findet man hier.
Die ersten beiden Geschichten kippen in einen surreal-groteske Stimmung: In „Ein Schauspieler bereitet sich vor“ ist der Ich-Erzähler ein schon gealterter Professor, der die Hände nicht von jungen Studentinnen lassen kann. Wie der Mittsommernachtstraum selbst endet auch die Geschichte lose, flackernd, in nebulösem Wirrwarr. Oft wird die Frage nach „schickt sich“ oder „schickt sich nicht“ aufgeworfen – wenn es um das Techtel-Mechtel zwischen Student und Professor geht, aber auch um das Verhältnis zu Drogen und Alkohol. Schlussendlich werden aber in dieser – wie auch in den anderen – Geschichten schnell die meisten Skruptel über Bord geworfen. Antrim, oder seine Charaktere, pfeifen getrost auf soziale Konventionen, wenn man so will. Auf gesellschaftliche Tabus. Der Professor, der gerne Bacchus wäre, umringt von Frauen und gutem Wein. Dass Antrim keiner Geschichte ein Happy End verpasst, scheint fast nicht erwähnungsnotwendig.
In „Teich mit Schlamm“ bekommt der fünfjährige Gregory Scotch mit Soda von seinem Stiefvater, nachdem ihn dieser in eine Bar mitgeschleppt hat:
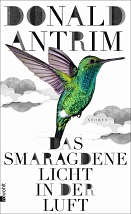
rowohlt
"Das smaragdene Licht in der Luft" ist in deutscher Übersetzung von Nikolaus Stingl im rowohlt Verlag erschienen.
Und damit beugte er sich dicht an Gregory heran, nahm den Scotch mit Soda vom Tresen, hob das Glas an die Lippen des Jungen und sagte: „Hier. Nicht weinen.“
Nein, du bist kein Künstler.
Mit leisem Sarkasmus nähert sich Antrim seinen Figuren, wenn er ihnen in etwas verhüllter Weise nicht zugesteht, Künstler zu sein. Der Schriftsteller misst seinen „guten“ Schreibtag daran, ob er keine Tintenflecken auf der Hose hat. Sein Notizbuch führt er beinahe neurotisch, muss alles immer sofort aufs Papier bringen, ja keine gute Idee verschwenden. Diese beinahe minütlichen Eingebungen enden dann meist in möchtegern-lyrischen Feststellungen über das Leben, die Antrim gewollt ins Lächerliche zieht. Die arrogante Haltung, sich für wichtig zu halten, als Schriftsteller etwas zu sagen zu haben, lässt Antrim Patrick nur einmal kurz abschütteln. In einem Moment der Selbstreflexion sagt er es zu sich selbst: Ich bin kein Künstler. Eigentlich habe ich nichts zu sagen.
Auch ist allen Charakteren gemein, dass sie sich wohl bewusst darüber sind, eigentlich nur eine selbst auserdachte Rolle zu spielen – diese aber auf keinen Fall abschütteln wollen. Man könnte hier auch noch einmal Antrims eigenes schriftstellerisches Selbstbewusstsein ins Spiel führen, das in so krasser Diskrepanz zur Hochachtung steht, die ihm Kollegen entgegen bringen.
Exzellent krank
„Das smaragdene Licht in der Luft“ ist das Ergebnis des achtjährigen Kampfes gegen die Psychose – genauso wie die Beschreibung des Zusammenbruchs selbst. Dies geschieht auf unterschiedliche Weise: Antrim schafft es, oft in grotesk-surrealer Manier, einmal den selbst Erkrankten, einmal den Beobachter zu mimen. Seine Geschichten sind überraschend, teils schockierend. Sie sind krank. Im positivst möglichen Sinn.


