Erstellt am: 23. 2. 2014 - 10:33 Uhr
A Series Matter
"Serienfan Obama bekommt Episoden vor Ausstrahlung"
(ORF.at, 19. Februar 2014)

dpa
Es war den Nachrichtenagenturen zwar nur eine Randnotiz wert, aber immerhin. Sogar der US-Präsident sei Serien-Blockbustern wie "Game of Thrones", "House of Cards" und dem neuen odd couple für aberwitzige Dialoge - McConaughey und Harrelson - in "True Detective" verfallen und wird von HBO und Co. sogar mit Vorab-Kopien neuer Episoden versorgt. Eigentlich ein kleiner medienpolitischer Skandal, ist der Normalverbraucher doch im Angesicht überbordender illegaler Verfügbarkeiten dem Sender-Zank um Erstausstrahlungs- und Weiterverwertungsrechte und dem Bandbreiten-Streit um Streaming-Geschwindigkeiten hilflos ausgeliefert. Anders ausgedrückt: Die Mächtigen können sichs wieder einmal richten und uns bleibt nur die Hoffnung, dass legale Angebote bald auch in unseren Breitengraden nur einen Mausklick entfernt sind.
Aber es sei Obama gegönnt. Denn tatsächlich sind TV-Serien inzwischen zu einer Art kulturellem Mainstream-Mojo avanciert, dem sich anscheinend auch unabhängig der oben genannten Zugangsmöglichkeiten kaum jemand entziehen kann und selten auch darf ("Was, du hast noch nicht die neuen Rezensionen auf AVClub zu "Orange is the new Black" gelesen?"). Sie weckten das Fernsehen im Schatten des Kinos aus seinem Winterschlaf und ließen völlig neue, vorher kaum dagewesene mediale und wissenschaftliche Zugänge im engsten Kreis zu: von Blumenaus metakritischen Abhandlungen, der FM4-Serie "FM4 in Serie" zu meinen nie minder besuchten Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Und auch ein ewiger Serien-Junkie wie Alan Sepinwall hat davon profitiert. Es war ein steiler Karrieresprung von seinen kleinen Blog-Einträgen zum großen TV-Kritiker der USA mit neuem Grundlagenwerk, das die Kassen klingen lassen wird. Passender Titel: "Die Revolution war im Fernsehen".
Die üblichen Verdächtigen
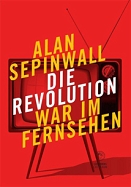
Luxbooks
Inzwischen kann die Liste jeder blind aufsagen: "The Sopranos", "Breaking Bad", "Mad Men", "24", "Lost", "The Wire" und das von Sepinwall unverständlicherweise nicht behandelte "Six Feet Under", haben Kulturgeschichte geschrieben. Jede dieser Serien hat dramaturgisch, gesellschaftspolitisch, kulturell, historisch und genrespezifisch neue, tiefe Fußstapfen hinterlassen bzw. das, was man als Qualität im Fernsehen bezeichnen könnte, einige Messlatten nach oben gesetzt und damit den Weg für "Game of Thrones" oder "Homeland" erst geebnet. Diese Serien haben alle noch etwas gemeinsam: ihre Zuschauer. Die Fan-Lager dieser Geschichten können locker mit jenen aktiver Fußballclubs mithalten, die Begründung ist eine ähnliche: die eigene Sozialisierung findet immer auch über Medien statt, über die individuelle Erfahrung, deren Wert erst dadurch wächst, dass man merkt, dass es anderen genauso geht. Auch ich habe (wie viele andere) bei der letzten Szene von "Six Feet Under" gleichzeitig gelacht und geweint. Und die Schlussnummer, Sias "Breathe", löst das heute noch aus - dazu reicht die nostalgische Erinnerung an die TV-Bilder in meinem Kopf.
Apropos Nostalgie. Don Draper hat in einem Kodak-Pitch in "Mad Men" einmal gemeint, Nostalgie sei nach der griechischen Wortbedeutung der Schmerz einer alten Wunde. Im Herzen sei sie viel mächtiger als die Erinnerung selbst. Das weiß auch Alan Sepinwall. Zwölf große (Drama-)Klassiker des Serienkanons bietet Sepinwalls neues Buch, essayistische Kolumnen für all jene, die keine Ahnung haben, was Crystal Meth ist und die sich auch nicht für das "vor dieser Zeit" interessieren: kein "Twin Peaks" oder "Dallas", sondern nur das "Golden Age" der neuen Ära. Aber auch keine Sitcoms, kein "Seinfeld", kein "Curb Your Enthusiasm", kein "South Park", kein "How I Met Your Mother". Das Argument, dass er den Fokus nur auf Serien mit fortlaufender Handlung lege, wird spätestens durch letztgenanntes Sitcom-Beispiel ausgehebelt. Nebenbei schreibt Sepinwall ausschließlich über US-amerikanische Serien (u.a. auch "Oz"), alles andere wird ignoriert.

HBO
Sepinwall konzentriert sich in seinem essayistischen Werk vor allem auf die Hintergrundstories und bietet so Einblicke in das Leben in der Fernsehbranche. Etwa, wie die legendären Ideen entstanden sein sollen: "Mad Men" entstand zum Beispiel, weil Autor Matthew Weiner unbedingt seine Eindrücke über die Periode 1950-60er festhalten wollte, bei ihm eine aalglatte und zynische Zeit, in der zuviel geraucht und getrunken wurde. Gleichzeitig für ihn auch das, was das Jahr 1955 in den "Zurück in die Zukunft"-Teilen ist: ein Punkt in der Zeit, in der sich Strömungen des Raum-Zeit-Kontinuums immer wieder zu treffen scheinen, auch noch Jahrzehnte danach.
Er erklärt auch, dass "Breaking Bad" beinahe nie auf Sendung gegangen wäre. Chef-Autor Vince Gilligan hatte für seine Idee gleich bei mehreren TV-Sendern vorgesprochen - ja regelrecht gebettelt - alle lehnten ab. FOX mit der einfachen Begründung, dass man keine Show haben wolle, die wie "Weeds" sei. Dass sich AMC dann erbarmt hat, lag nicht zuletzt am Erfolg von "Mad Men", für das der Sender bereits ein Nachfolgeprojekt mit einem klassischen Anti-Helden suchte. Bingo.
AMC
A Dying Hype?
Sepinwalls Buch ist ein romantischer, regelrecht verträumter Blick auf unser aller Lieblingsserien. Wie ein altes Fotobuch, das man Jahre später aufklappt. Anekdoten werden eingestreut, Handlungsstränge liebevoll nacherzählt, medienunternehmerische Machtspiele aufgedeckt. Aber bei all der Idealisierung darf man durchaus kritischer analysieren und (mit Absicht ein bisschen böse) fragen: Ist das Ganze nicht schon ein bisschen am absteigenden Ast? Dramaturgische Experimente wie "24" oder "Lost" liegen nun auch schon ein paar Jährchen zurück und anfängliche innovative Aufreger wie "Dexter" waren am Ende bestenfalls ein Gähnen wert (Lumberjack, seriously?). "Homeland" ist mit Sicherheit kein zweites "Breaking Bad", was die enorme universelle Identifikation angeht und vor dem Spin-Off von "How I Met Your Mother" mit Greta Gerwig habe ich jetzt schon Angst. Anders ausgedrückt: Der Markt wird sich früher oder später übersättigen und ist es teilweise schon, da die Konkurrenz der Produkte größer ist als noch zu Zeiten von "The Sopranos" oder "Lost".
"Lost" war ein Fernseh-Ereignis. Menschen haben darüber gegrübelt, wie sie am schnellsten an ihren Stoff kurz nach Release kommen, um mitreden zu können. Das "Golden Age" war überhaupt erst möglich, weil die ohnehin schon geringe Aufmerksamkeitsspanne gegenwärtiger Medienrezeption zumindest ein überschaubares Programm benötigt, um mitzukommen. Heute weiß man gar nicht mehr, wo man zuerst hinschauen muss, um sich noch auszukennen (was u.a. auch an den Produktionskanälen Netflix, Amazon und Co. liegt, die klassischen TV-Sendern Konkurrenz machen).
Die hohen Investitionen der letzten Jahre in serielle Produktionen (unabhängig ob TV oder Netz) liegen vor allem an rückläufigen Gewinnen großer Blockbuster-Filmproduktionen (hohe Investitionsbeträge zeigen sich nicht zuletzt an der Qualität der Fernsehprodukte). Serielles Erzählen hatte aber immer größere Möglichkeiten Zuschauer zu binden, selbst wenn durch veränderte Nutzungsbedingungen (z.B. on Demand) das Warten auf neue Folgen eine geringere Rolle spielt als früher noch (damals liefen z.B. sogenannte "Chapter Plays" inklusive Cliffhanger vor Kinofilmen , die Zuschauer dazu bringen sollten für die Fortsetzung auch in den nächsten Film zu gehen). Der derzeitige Fortsetzungswahn bei Filmen ("Pirates of the Caribbean", "Hangover", "Transformers", "Iron Man", "Thor", "Avengers", etc.) hat nicht zuletzt davon profitiert (Sozialisierung durch den ersten Teil, gleiches Figuren-Ensemble, vernetzte Erzählstränge, oft sogar mit Cliffhanger zwischen Teilen). Böse angemerkt könnte man fast sagen, dass die spannensten Serien der letzten Monate eigentlich gar keine "klassischen" Serien á la "Dallas" mehr sind, sondern sich lediglich das Serielle für kurze Zeit zu eigen machen: "True Detective", "Top of the Lake" oder "Sherlock".
Weitere Leseempfehlungen:
Trotzdem: I love my series. Ich lese Reviews über Shows, die ich vielleicht nie sehen werde oder erst angefangen habe, weil es schwierig ist sie alle zu verfolgen (z.B. "Orphan Black", immer noch will ich "Masters of Sex" oder "Treme" nachholen. Die Amazon-Serie mit John Goodman muss auch noch sein), obwohl ich diesen Drang bei Filmen, Büchern oder Musik nicht verspüre. Das ist wohl die Stärke des Seriellen. Aber Sepinwalls Werk, so liebevoll es ist, ist mehr eine nostalgische Abhandlung alter Serien, als ein aktueller Befund über die unsichere Zukunft des Seriellen, die sich durch die Verlagerung auf digitale Plattformen weiter von der "Goldenen Ära" entfernen wird. All das mit einem erzählerischen Duktus, als könne man die großen Legenden wie "Lost" und Co. nur noch durch (Weiter)-Erzählen am Leben erhalten, damit auch spätere Generationen sie kennenlernen.
Aber wenn wir ehrlich sind: nur so bleiben Geschichten überhaupt am Leben. Auch wenn die alte Wunde dadurch wieder schmerzt.


