Erstellt am: 9. 2. 2014 - 17:23 Uhr
NSA-Spionage wird Topthema im EU-Wahlkampf
Die Geheimdienstsspionage und damit die digitalen Bürgerrechte werden zu einem bestimmenden Thema bei den Wahlen zum EU-Parlament Mitte Mai. Den Auftakt dazu setzte am Mittwoch Martin Schulz, Parlamentspräѕident und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, mit einer eindringlichen Warnung vor "digitalem Totalitarismus" in der "Frankfurter Allgemeinen".
Damit ist erstmals der gesamte Themenkomplex "Bürgerrechte und Datenschutz" Spitzenthema in einem EU-Wahlkampf. Die amtierende Kommission von Jose Manuel Barroso hat in dieser Beziehung eine denkbar schlechte Bilanz vorzuweisen, doch auch hier sind die Weichen nun neu gestellt. Durch den Vertrag von Lissabon hat das Europäische Parlament zum ersten Mal bei der Besetzung der Kommission entscheidend mitzureden. Bis dato wurde die Kommission nicht gewählt, sondern von den Mitgliedsstaaten eingesetzt.
Die NATO-Mehrheit im Ministerrat
Gerade in puncto Datenschutz und Bürgerrechte wurden hier kleinere Staaten wie Österreich von den stimmenstarken EU-Mitgliedern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen mit schnöder Regelmäßigkeit überfahren (siehe weiter unten). All diese Staaten, die zusammen eine haushohe Mehrheit im Ministerrat bilden, aber gehören der NATO an.
Die Vorgaben für die Kommission kamen in vielen Fällen nachweislich nicht einmal aus Europa, sondern von der G7-Allianz, die von den USA und mehreren NATO-Staaten angeführt wird. Und so sah die Politik der Kommission Barrosos denn auch aus. Bei allen wichtigen Fragen wurden seitens der Kommission so gut wie immer die Positionen von Großkonzernen und/oder der NATO vertreten. Die Interessen europäischer Bürger und deren Rechte wurden grundsätzlich immer unter "ferner liefen" nachgereiht.
Neuartige Wahlversprechen
Die zehn Gebote für digitale Bürgerrechte von "European Digital Rights" samt der Liste der ersten, unterzeichneten Abgeordneten zum EU-Parlament.
Ein Vergleich mit dem durchwegs nicht parteipolitisch ausgerichteten Forderungskatalog des Dachverbands der europäischen Bürgerrechtsorganisationen (EDRi) zeigt diese Linie der Kommission in krasser Deutlichkeit. Seit Donnerstag sind zehn Forderungen für digitale Bürgerrechte und Datenschutz auf dem Wahlportal Wepromise.eu einsehbar. Neuartig ist das Portal insofern, weil es dialogisch aufgebaut ist. Nicht nur Politiker, sondern auch alle Bürger der Union können hier ein Wahlversprechen abgeben.
Politiker verpflichten sich da, ihr künftiges Abstimmungsverhalten an den zehn Punkten zum Schutz - eigentlich zur Wiederherstellung - der digitalen Bürgerrechte im Netz einzuhalten. EU-Bürger wiederum können auf Wepromise.eu deklarieren, dass sie erstens zur Wahl gehen und zweitens jenen Kandidaten ihre Stimme geben werden, die diese zehn Gebote auch einhalten.
Österreich im Vorderfeld
Mit Stand von Sonntag haben bereits 13 Abgeordnete unterzeichent, darunter sind auch drei aus Österreich: Evelyn Regner, Josef Weidenholzer (beide SPE) und Martin Ehrenhauser (fraktionslos). Deutschland führt derzeit mit vier Abgeordneten vor Österreich und Schweden die Liste an. Damit sind bereits jetzt Abgeordnete von vier der fünf großen Fraktionen im Europäischen Parlament vertreten: Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und die Linke.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch einzelne EU-Parlamentarier und Kandidaten der derzeit größten Fraktion EVP oder auch einzelne Rechtspopulisten dort aufscheinen werden. Die zehn Punkte sind nämlich so neutral formuliert, dass Partei- und Fraktionsgrenzen eigentlich keine große Rolle spielen dürften, weil die Forderungen im herkömmlichen Links-Rechts-Parteienschema nicht zu verorten sind.
"Transparenz, Beteiligung der Bürger"
Praktisch alle wahlwerbenden Parteien aus Österreich haben das erste der zehn EDRi-Gebote, "mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung" in ihren Wahlprogrammen. EU-Kommission und Ministerrat haben hingegen in all den Jahren bis heute das nachgerade Gegenteil davon praktiziert. Vom "Antipiraterie"-Vertrag ACTA angefangen bis zum aktuellen Freihandelsabkommen (TTIP) wurden und werden die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt.

CC EU Council
Im Register des EU-Ministerrats wurde eine Version des Dokuments veröffentlicht, in der just die entscheidende Passage zensuriert ist, weil "not declassified".
Nicht einmal EU-Parlamentarier dürfen den Verhandlungsstand einsehen, die Lobbyisten der internationalen Großkonzerne aber sitzen von Anfang an mit am TTIP-Verhandlungstisch. Davor schon wurde der europäischen Delegation, die vom Ministerrat in die USA geschickt wurde, um dort Fragen rund um die NSA-Spionage zu klären, vom selbigen Ministerrat das Mandat dafür entzogen. Da der Text dieses Nicht-Mandats bis heute nicht öffentlicht einsehbar ist, wird er hier unter einer freien Creative-Commons-Lizenz zur Verfügung gestellt.
"Stärkung des Datenschutzes"
Bei Punkt zwei der Forderungen, "Stärkung des Datenschutzes in Europa", ist die Bilanz von Kommission und Ministerrat genauso negativ. Nachdem die parlamentarischen Verhandlungen zur Novelle zum EU-Datenschutz im Herbst kurz vor dem parlamentarischen Abschluss standen, wurden sie durch den Ministerrat in letzter Minute torpediert.
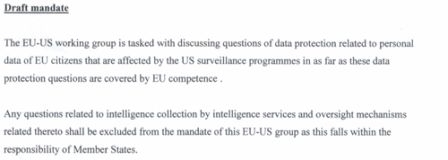
CC EU Council
Ein dort erstelltes, höchst umstrittenes Rechtsgutachten genügte, um die Datenschutzreform bis zu den Wahlen im Mai auf Eis zu legen. Das entspricht der seit 15 Jahren sattsam bekannten Linie im Ministerrat. Man setzt darauf, mit den vielen, dann neu im Parlament vertretenen Abgeordneten, die sich in eine komplexe Materie einarbeiten müssen, leichteres Spiel zu haben.
"Uneingeschränkter Internet-Zugang"
Ihr jahrelanges aber letzlich erfolgloses Eintreten für eine Zensurinfrastruktur im Internet - angeblich gegen "Kinderpornografie" hat EU-Kommissarin Cecilia Malmström den Spitznamen "Zensilia" eingebrockt. Was damit wirklich bezweckt wurde, zeigt der Umstand, dass die Internetsperren einmal als Maßnahme gegen "Rekrutierung von Terroristen" und zuletzt wegen Urheberrechtsverletzungen wieder auf der Tagesordnung standen.
Das dritte Bürgerrechtsgebot, "uneingeschränkter Zugang zum Internet" hat die Kommission Barroso Zeit ihres Bestehens systematisch auszuhebeln versucht. Für die zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström hatte vielmehr die Einführung einer technischen Infrastruktur zur Filterung und Zensur des gesamten Internetverkehrs oberste Priorität.
Am aktuellen Fall der Debatte um die Netzneutralität ist diese Positionierung der Kommission wieder klar ersichtlich. Allen Beteuerungen von Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes zum Trotz fanden sich noch in jedem Entwurf der Kommission dieselben Passagen wieder, die europäischen Telekomkonzernen das Recht einräumen, sämtliche Internetdienste je nach eigenen Geschäftsinteressen einzubremsen oder zu priorisieren. Dabei haben die Telekoms bereits von Anfang an die Möglichkeit, ihre Angebote nach Bandbreite und Datenvolumen finanziell zu staffeln. Nun verlangen sie dіrektes Eingriffsrecht in den Informationsfluss selbst.
Rechtspopulisten
Wer nun, wie etwa die FPÖ, dafür plädiert, die "Rechte der Mitgliedsstaaten zu stärken", oder gar ein "Europa der Vaterländer" ausrufen will, wie es rechtspopulistische und -extremistische Parteien aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen oder Rumänien anstreben, wird den Ist-Zustand de facto zementieren. Aus diesem Parteispektrum soll sich mit der FPÖ nun eine neue Fraktion bilden, wie FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache mehr als einmal angekündigt hat.
2008 hatte die amtierende Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes groß angekündigt, dass die EU die Umsetzung ihrer eigenen Vorgabe von 2007, selbst mehr freie Software und offene Standards zu nutzen, "kraftvoll" implementieren werde. Das entspricht Gebot zehn im aktuellen Forderungskataolog von EDRi. Fünf Jahre lang hat Neelie Kroes genau nichts dafür gemacht.
Die Mitgliedsstaaten repräsentiert nun einmal der Ministerrat, die Anzahl der Stimmen dort ist etwa proportional zur Bevölkerung. Die acht stimmenstärksten Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien (je 29), Spanien und Polen (je 27), Rumänien (14) und die Niederlande (13), die allesamt der NATO angehören, können dort jeden Beschluss mit einfacher Mehrheit durchsetzen. Sodann ergeht ein Auftrag an die Kommission, diesen Beschluss auch umzusetzen.
Von der Vorratsdatenspeicherung angefangen war dies der Ursprung aller umstrittenen Richtlinien und Beschlüsse. Die einzige frei gewählte Institution der "drei Säulen" in der Union, das Parlament, konnte vielfach nur das Ärgste verhindern.
Die Rolle der EVP
Wie unsinnig es ist, die EU-Wahlen allein nach dem überkommenen Rechts-Links-Parteienschema herunterzubrechen, zeigt sich exemplarisch am Verhalten der EVP-Parlamentarier aus Österreich in wichtigen Fragen. Zwar wurde die allgemeine Stoßrichtung der konservativen Fraktion in allen Fällen von der EVP erst einmal mitvertreten. Sobald sich jedoch abzeichnete, dass man mit dieser Linie auf Konfrontationskurs zu österreichischen Interessen geht, hatte die EVP ihr Stimmverhalten schließlich an den Interessen Österreichs und nicht jenen der NATO-Mehrheit ausgerichtet.
ACTA wurde im Juli 2012 mit großer Mehrheit abgelehnt. Damit erhielt die EU-Kommission die Quittung für die jahrelange Geheimhaltungspolitik.
Bei den umstrittenen Softwarepatenten, die allein im Interesse der europäischen Autohersteller waren, aber europäische Klein- und Mittelbetriebe und freie Programmierer schwer getroffen hätten, war die EVP letzendlich ebenfalls auf Seiten aller anderen österreichischen Parteien, samt den fraktionslosen MEPs.
Was abgeschossen wurde
Die Patente auf Software wurden vom EU-Parlament zwar mühevoll aber letzendlich erfolgreich abgeschossen, ebenso wie das "Antipirateriabkommen" ACTA sechs Jahre danach. Kein einziger EU-Parlamentarier aus Österreich hatte für ACTA gestimmt.
Österreichische EU-Parlamentarier von EVP, SPE und Grünen haben großteils deckungsgleiche Vorbehalte gegenüber dem TTIP-Abkommen geäußert.
Dem völlig gleichgelagerten und daher höchst umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP droht nun dasselbe Schicksal. Der Umstand, dass der geostrategisch-militärische US-Thinktank Atlantic Council TTIP neuerdings als "ökonomische NATO" bezeichnet, stellt für österreichische Wähler am 25. Mai auch keine Entscheidungshilfe dar. Keine der wahlwerbenden Parteien aus Österreich tritt mehr offen und uneingeschränkt für dieses Abkommen ein.
Was die amtierende Kommission unter der Führung von Jose Manuel Barroso betrifft, so hat die nicht etwa versagt, wie es ihr Kritiker vorwerfen. Sie hat die Überwachung und digitale Entmündigung der EU-Bürger vielmehr aktiv und ziemlich effizient vorangetrieben, immer im Auftrage der Stimmenmehrheit im Ministerrat.


