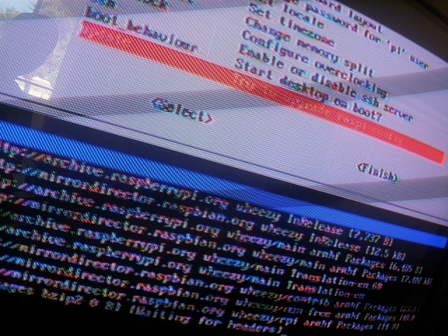Erstellt am: 22. 1. 2014 - 18:43 Uhr
Digitale Waffen
IT&Games
Hacking, digitale Überwachung und der NSA-Skandal
In falschen Händen verwandeln sich Überwachungsprogramme in digitale Waffen, kritisiert die niederländische Europaabgeordnete Marietje Schaake und warnt davor, dass Trojaner und andere Ausspähprogramme für überwachte Personen genauso gefährlich werden könnten, wie herkömmliche Waffen. Erst im September wurden Wikileaks-Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass europäische Firmen Überwachungstechniken an autoritäre Regime liefern. Schaake hat die Kampagne "Stop Digital Arms" gestartet und unterstützt damit die Bürgerrechtsorganisationen Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen, die schon länger nach Regulierung rufen. Es sei paradox, so Reporter ohne Grenzen Berlin, wenn Europa betone, wie wichtig es sei, dass Bürgerjournalisten unter Einsatz ihres Lebens Informationen aus autoritären Staaten liefern, während europäische Firmen die Machthaber dieser Staaten gleichzeitig mit Überwachungstechnik versorgen.

Bram Belloni
Auch Marietje Schaake sieht hier die Verletzung von Menschenrechten und schließt sich dieser Kritik an: "Viele Bürger in Europa sind empört, in welchem Ausmaß der amerikanische Geheimdienst NSA Bürger weltweit überwacht, wie die NSA uns überwacht. Aber nicht nur die NSA setzt Überwachungstechnologien ein. Regime in Nordafrika oder im Nahen Osten nutzen Überwachungssoftware und verfolgen damit, wer mit wem kommuniziert, wer sich mit wem trifft. Sie verfolgen die Leute, sie spähen sie aus und sie hacken ihre Computer und Mobiltelefone."
Digitale Waffen sind zum Beispiel Trojaner: also Spionagesoftware, die in Mobiltelefonen und Computer geschmuggelt werden kann, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und auch digitale Einbruchs-Werkzeuge werden gerne exportiert: Firmen suchen und verkaufen Schwachstellen, die es in jedem Computerprogramm gibt. Mit Hilfe dieser Sicherheitslücken kann dann in die fremde Computer eingebrochen und Kontrolle über sie erlangt werden.
Marietje Schaake berichtet von Aktivisten, die während der Folter mit Inhalten ihrer eigenen Kommunikation konfrontiert worden sind: "Wir müssen die Auswirkungen von Technologien, die Massenüberwachung und das Verfolgen und Aufspüren von Leuten ermöglichen, sehr ernst nehmen. Menschenrechte und Meinungsfreiheit sind hier stark bedroht."
Laut Wikileaks-Dokumenten produzieren und exportieren vermehrt deutsche Firmen digitale Werkzeuge für den Überwachungsstaat. Der Handel mit digitalen Waffen sei in Europa aber kaum reguliert, kritisiert Marietje Schaake, Embargos gäbe es nur für Extremfälle wie Iran und Syrien, sonst herrsche ein rechtliches Vakuum: "Viele Firmen agieren unter dem Radar. Aber es geht um Firmen, die an Machthaber in Syrien, Ägypten, Iran und Bahrain liefern. In Länder, in denen es an Menschenrechten, Meinungsfreiheit, dem Recht auf Information und Rechtsstaatlichkeit mangelt."
Einige Firmen sind dank der Arbeit von investigativen Journalisten und NGOs schon der Öffentlichkeit bekannt. Auch die Werbesprüche von Firmen, die Überwachungssoftware verkaufen, sprechen für sich: "Wozu einen elektrischen Stuhl verwenden, um Leuten Informationen zu entlocken, wenn ihr die Informationen auch mit unserer Überwachungssoftware herausfindet?"
Die Europaabgeordnete setzt sich für einheitliche Regeln für europäische Firmen ein und kritisiert die Untätigkeit der EU-Kommission. Schaake schlägt zum Beispiel Nutzungslizenzen für Überwachungssoftware vor. Und Firmen sollen nachweisen, dass sie an Länder exportieren, in denen die Menschenrechte eingehalten werden. Schaake appelliert: "Es ist höchste Zeit, dass wir in der Europäischen Union einheitliche Regeln schaffen, damit Firmen transparent und verantwortlich handeln und wir den Export von digitalen Waffen drosseln können. Und dass wir unsere guten Vorsätze auch in die Tat umsetzen."