Erstellt am: 28. 6. 2013 - 09:00 Uhr
Copyright-Barrieren für Blindenbüchereien fallen
Auf der Konferenz der World Intellectual Property Organization WIPO, die heute zu Ende geht, kam Dienstag nächtlicher Jubel auf, vor allem unter den anwesenden Blinden und ihren Vertretern.
Da hatte sich erstmals abgezeichnet, dass die US-Delegation ihre Blockade gegen umfassende Copyright-Ausnahmen für Sehbehinderte beenden würde. Die USA, sowie die Delegationen mehrerer anderer Staaten vor allem aus der EU hatten großzügige Regelungen für Blinde bis dahin blockiert.
Die Lobbyisten von Verlagen, Filmindustrie aber auch von multinationalen Konzernen, die mit der Produktion von Büchern oder Fimen überhaupt nichts zu tun haben, wollten (siehe unten) - verhindern, was sie als Präzedenzfall sehen.
Erstmals Öffentlichkeit
Im Fall der Sehbehinderten, für die es seit Mitte der 90er Jahre immer mehr Hörbücher in einem eigenen, standardisierten Audioformat gibt, hielt diese Barriere mehr als 15 Jahre lang. Der nunmehrige Durchbruch ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass diese WIPO-Konferenz schon im Vorfeld erstmals von öffentlichen Diskussionen begleitet wurde.
Diese Öffentlichkeit fand weder in Print noch auf den Internetportalen der Verlage oder im TV statt, denn kaum ein Breitenmedium berichtete zum Thema ebensowenig wier über die Konferenz. Für Öffentlichkeit sorgten seit 2008 vielmehr eine Handvoll unabhängiger Organisationen (NGOs) angeführt von "Knowledge Ecology Online" (KEI), einer Hilfsorganisation, die sich seit Jahren unter anderem für Blinde einsetzt. Dazu kamen Blogger wie Mike Masnick vom IT-Fachportal Techdirt und anfangs nur einige, wenige Abgeordnete des EU-Parlaments, allerdings aus mehreren Fraktionen.
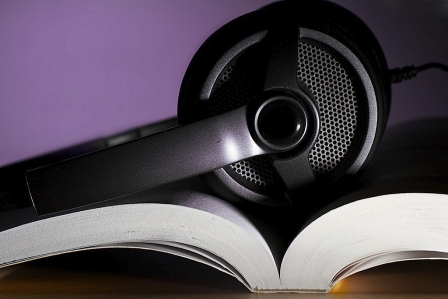
CC flickr.com/jeffanddayna
Druck des EU-Parlaments
Diese MEPs hatten die Vertreter der EU-Kommission mit wachsender Unterstützung aus allen Fraktionen bei Hearings und im Plenum immer mehr unter Druck gebracht. Auch konservative Abgeordnete, die zuletzt in Sachen ACTA und EU-Datenschutzpaket als Industrie-Hardliner Profil gezeigt hatten, waren sehr bald dabei, die Beschlüsse waren tendenziell einstimmig. Die Blockade bestand aber immer noch im EU-Ministerrat, also auf nationalen Ebenen. In Marrakesch wurde in der UN-Teilorganisation WIPO auf eben diesem Level verhandelt.
In einer ersten Stellungnahme nach der Lektüre dieses komplexen, neuen Vertragswerks zeigte sich die Abgeordnete Eva Lichtenberger (Grüne) überrascht, dass die wichtigsten Barrieren für Blinde tatsächlich weg oder fast eingeebnet sind. Lichtenberger war eine der ersten MEPs dieser fraktionsübergreifenden Initiative, die im Justizauschuss des EU-Parlaments begonnen hatte.
Beim Start der Konferenz am 17. Jui war von einem Durchbruch nichts zu bemerken gewesen. Der österreichische Blindenverband hatte sich auf Anfrage von ORF.at relativ pessimistisch über den Ausgang der Verhandlungen gezeigt.
Dramatische Verbesserung
Weltweit werde der WIPO-Vertrag "eine dramatische Verbesserung beim Zugang zu Lesestoff bringen", heißt es in einer ersten Reaktion von James Love, der für KEI aus Marrakesch berichtet. "Damit ist der Grundstein für internationale Blindenbibliotheken gelegt", denn nun werde es auch möglich, Hörbücher grenzüberschreitend unbürokratisch an Einzelpersonen weiterzugeben.
Bis jetzt haben eine Anzahl von Copyright-Regeln, die eins zu eins auf Hörbücher für Blinde übertragen wurden, verhindert, dass in größerem Stil von den Blindenverbänden produzierte Hörbücher ausgetauscht werden durften.
Deutschland und Österreich
Der Bezug von Büchern durch Blinde ging bis jetzt streng nach Landesgrenzen. In die Audiobibliothek des österreichischen Blindenverbands dürfen bis jetzt zum Beispiel die vom deutschen Blindenverband für deutsche Blinde eingelesenen Hörbücher nicht aufgenommen werden.
Das wird nun anders, sobald die nationalen Gesetze diesbezüglich angepasst sind. Für die Blinden in Österreich, die dadurch bald einfachen und unbürokratischen Zugriff auf die Bestände der deutschen und Schweizer Blindenbibliotheken haben werden, vervielfacht sich in absehbarer Zeit das Angebot. Derzeit stehen den Sehbehinderten nur etwa fünf Prozent der Bücher zur Verfügung, auf die Sehende Zugriff haben.
James Love und die anderen Aktivisten von KEI haben das Werden des neuen Vertragswerks von Beginn an minutiös verfolgt. Die Interventionen seitens der Inhaber "geistiger Eigentumsrechte" richteten sich nämlich keineswegs an eine breitere Öffentlichkeit, sondern erfolgten rein intern. KEI klagte unter anderem nach dem US-Gesetz für Informationsfreiheit, worauf der Mailverkehr zwischen der MPAA und dem US-Patentbüro zum Thema öffentlich wurde.
Afrika, Südamerika
In Afrika und anderen ärmeren Weltregionen sind es gar nur ein bis drei Prozent an Büchern, die dort zur Verfügung stehen. In naher Zukunft haben Blinde in den frankophonen Staaten Afrikas Zugriff auf die in Frankreich aufgenommenen Hörbücher. In Lateinamerika wird der Zuwachs an Bildungsmöglichkeiten für Blinde voraussichtlich noch drastischer ausfallen, wie sich das bescheidene Angebot für Blinde in der arabischsprachigen Welt enorm ausweiten wird.
Unter diesen "Büchern" sind Audiodateien zu verstehen, die in einem speziell für Blinde entwickelten Standardformat namens "Daisy" erstellt werden. Damit lassen sich nicht nur Lesezeichen, sondern auch eigene Anmerkungen, Fußnoten und Querverweise setzen, die der blinde "Leser" selbst dazu aufnimmt.
Hörbücher der anderen Art
Für Menschen mit normalen Sehfähigkeiten ist ein solches Format nutzlos, herkömmliche Hörbücher unterscheiden sich von solchen für Sehbehinderte auch grundlegend. Das eine sind zumeist von prominenten Stimmen aufgesprochene Exzerpte aus belletristischen Werken. Blindenhörbücher sind hingegen vollständig und bieten eine breite Palette von Lehr- und Sachbüchern zu medizinischen, technischen und vielen anderen naturwissenschaftlichen Gebieten an.

CC flickr.com/psd
Für die Verlage stand also überhaupt nicht zu befürchten, dass sich Copyright-Ausnahmen für Blinde auf die Umsätze auswirken könnten.
MPAA, Exxon und Monsanto
Dennoch setzte man im Vorfeld alles daran, eine Lockerung der Coypright-Vorschriften für Blinde zu verhindern. Federführend daran beteiligt waren nach Angaben unabhängiger Konferenzteilnehmer die Verlage Pearson (Penguin) und Random House (Eigentümer Bertelsmann) und der internationale Arm der Filmlobby Motion Picture Association of America (MPAA).
Doch auch Exxon, General Electric, Monsanto und andere ließen ihre internationalen Rechtsabteilungen aufmarschieren. Die Folge waren Einsprüche gegen Copyright-Ausnahmen für Blinde, die so sorgfältig formuliert waren, dass es schwierig war, zu erkennen, was überhaupt gemeint war.
Die Methoden der Konzerne
Warum aber werden Mineralöl-, Saatgut- und Elektronikkonzerne in einem internationalen Vertrag über den Zugang Blinder zu Lesestoff überhaupt als "Stakeholder" angesehen? Ganz einfach deshalb, weil es um "geistige Eigentumsrechte" geht und diese Konzerne ihre diesbezüglichen Interessen bei jedem internationalen Vertrag der irgendetwas mit "geistigem Eigentum" zu tun hat, mit Macht einbringen.
Ziel ist dabei stets, sämtliche Veränderungen der Verwertung "geistigen Eigentums" nach Kräften zu verhindern. Dabei wird praktisch immer versucht, die für eigene Geschäftsinteressen wichtigen Passagen der Vertragswerke in "Kompromisse" zu verwandeln, die oft direkt gegen den Ansatz des Vertrags gerichtet sind.
Am Beispiel der "verwaisten Werke"
Ein Beispiel für ein verwaistes Werk: Ein Unbekannter hat ein paar Minuten einer privaten Feier mit Attila Hörbiger und unbekannten Kollegen vom Burgtheater abgefilmt. Man singt, im Hintergrund spielt ein Piano und damit ist der Copyright-Albtraum für einen Dokumentaristen bereits komplett. Hörbiger wird kein Problem sein, neben allen Darstellern müssen aber auch der Kameramann sowie Komponist und Pianist durch "sorgfältige Suche" ausgeforscht werden.
Sehr klar war diese Strategie der Obstruktion aus der Entwicklung der EU-Richtlinie zu "verwaisten Werken" abzulesen. Dieses Regelwerk war in seiner ursprünglichen Form dazu angelegt, Teile der riesigen, historischen Archivbestände an Audio- und Videomaterial EU-weit wieder zu erschließen.
Das sollte Dokumentaristen und Historikern, Filmemachern, Pädagogen und allen anderen Interessierten ermöglichen, historisches Film- und Audiomaterial aus den vergangenen 70 Jahren zu verwenden. Das weitaus meiste davon ist in einem oder mehreren Aspekten verwaist, weil Kameraleute oder Regiѕseure von Wochenschauberichten, die Darsteller, oder der Komponist der Musikuntermalung unbekannt sind.
Fülle und Lücken
Bei privatem Filmmaterial, oder Mitschnitten von Theateraufführungen müssen ebenso alle in einem Filmabschnitt gezeigten Personen ausgeforscht und deren Nachfahren wegen der Filmrechte kontaktiert werden.
All das betraf ausschließlich Material, das seit Jahrzehnten aus dem Verwertungskreislauf ausgeschieden ist, aber Geschichte und Kultur des 20. Jahrhunderts in Audio und Video dokumentiert. Es ist in ungeheurer Fülle in privaten und öffentlichen Archiven vorhanden, großteils nicht gesichtet und durch die Umstände bedingt nur äußerst lückenhaft kategorisiert.
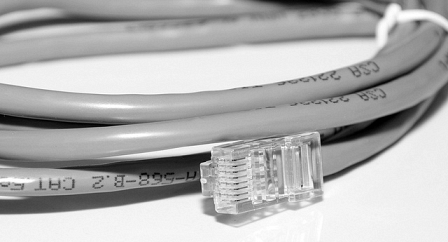
http://www.flickr.com/photos/free-stock/
Als ein EU-Parlamentsentwurf vorlag, der tatsächlich ermöglicht hätte, dieses historische Material in größerem Ausmaß wieder veröffentlichbar zu machen, griff die Lobbymaschinerie der großen Konzerne in das Geschehen ein. Danach war an dem Parlamentsentwurf der "Richtlinie zu verwaisten Werken" im Wortlaut zwar nicht sehr viel verändert.
"Treaty Poisoning"
Der Endstand der EU-Richtlinie zu den verwaisten Werken, die Mitte September 2012 vom EU-Parlament beschlossen worden war.
Es wurden lediglich ein paar Prüfungsauflagen hineingeschrieben, das Ganze wurde als "Kompromiss" dargestellt, wie es eben üblich ist. Der Kompromiss bestand darin, dass diese Richtlinie genau das nicht mehr leistete, wozu sie ins Leben gerufen worden war. Die Barrieren waren weiterhin vorhandene Prüfungsauflagen und ein Verbot kommerzieller Nutzung, die es nicht einmal Museumsshops ermöglichen, das Material auf DVD an die Besucher zu vertreiben.
Für diese Vorgangsweise der Lobbys hat sich längst ein Begriff eingebürgert, Man nennt es allgemein "Treaty Poisoning", also Vertragsvergiftung, eine Methode, die in Politik wie Wirtschaft international verbreitet ist und alle möglichen Vertragswerke betreffen kann.
Rückzug in Marrakesch
Die noch informelle Version des konsolidierten, neuen WIPO-Vertragstexts, die in Marrakesch verteilt wurde, ist bereits im Netz. Es ist nicht damit zu rechnen, dass an diesem Wortlaut noch signifikante inhaltliche Änderungen vorgenommen werden.
Die Barrieren für Blinde waren deshalb in Marrakesch gefallen, weil sich Filmindustrie, Großkonzerne und Verlage angesichts des wachsenden, öffentlichen Interesses in einer zunehmend prekären Position wiederfanden. Sie standen erstmals in einer Rolle im Licht der Öffentlichkeit, die ihnen überhaupt zusagte: Als jene, die aus wirtschaftlichen Interessen verhindern, dass Blinde Zugang zu Wissenschaft und Kulturgut erhalten.
Als erste hatte offenbar die Filmindustrie die Unhaltbarkeit der eigenen Position erkannt, seit mehreren Wochen umwarb man die Blinden sowohl in den Gesprächen wie auch öffentlich. Der Weltblindenverband ließ sich schließlich zu einer gemeinsamen Erklärung mit der durch die MPAA repräsentierten Filmwirtschaft überreden. Die hatte nämlich ein Ziel da schon erreicht. Die ursprünglich ebenfalls vorgesehenen Erleichterungen für Gehörlose waren längst gestrichen, Menschen mit Hörbehinderungen kommen als "Stakeholder" nicht mehr vor.


