Erstellt am: 4. 7. 2012 - 10:25 Uhr
TV Trio Infernal (2)
CHRISTIAN: Als wir für den ersten Teil dieser kleinen Serien-Reflexionen im virtuellen Gastgarten zusammengesessen sind, haben wir vor allem auch von emotionaler, sozialer, politischer Verunsicherung und fatalen Lebenskrisen gesprochen. Von TV-Helden und Heldinnen, die am Rande des Nervenzusammenbruchs herumtaumeln und uns Katharsis-Junkies dabei in den Abgrund mitreißen.
CHRISTOPH PRENNER ist als Schreiber, Partymacher und Partymusikmacher tätig. Schaut daneben aber auch immer wieder mal Filme und Serien.
SEBASTIAN SELIG lebt im Kino, besitzt aber auch einen Fernseher, neben dessen wuchtiger Größe sich einige DVD-Serien-Pappschuber stapeln. Die mögen rein äußerlich, mit ihren trist lieblos gestalteten Covern, an Hausfrauenromane erinnern, in ihrem Inneren glitzert und funkt es dann aber doch beträchtlich.
Diesmal lassen wir drei - Sebastian Selig, Christoph Prenner und meine Wenigkeit - die zwingende Ernsthaftkeit und den therapeutischen Charakter, den wir so am amerikanischen Fernsehwunder schätzen, ein wenig ruhen. Und geben uns stattdessen dem Rausch des puren Eskapismus und des plakativen Gelächters hin.
CHRISTOPH: Humor, du hochindividuelle Herrlichkeit. Wo manch einer bevorzugt auf jene Art von Comedy schwört, die möglichst nah an die eigenen Lebenswelterfahrungen dran komponiert ist (aktuell erfolgreichstes Beispiel hierfür: „Girls“), kann mir meine Humorheimat gemeinhin gar nicht überzeichnet genug sein. Da spielt es dann gar keine große Rolle, ob nun das gut und gern auch von dir oder mir potentiell so alltäglich Erlebte in eine Art zur Groteske aufgepumpte Hyper-Realität überführt wird wie im fulminanten „Louie“. Oder ob da umgekehrt nachgerade als Comicfiguren etablierte Charaktere mehr oder minder hart am Wandverbau der Wirklichkeit aufprallen wie in sehr charmant abgefederter Form in „Parks and Recreation“ oder eben holzhammerhart wie in „Eastbound & Down“.
CHRISTIAN: Ah, Kenny F+++++g Powers!

HBO
SEBASTIAN: Tatsächlich gibt es da wenig, was sich in mehr als 21 Folgen packen ließe, das mich derart nah berührt, wie der brachial schmerzhafte Bumms dieses Ausnahmeathleten, geradezu mystisch real verkörpert von Danny McBride. Da steckt soviel echter Schmerz drin, umso schmerzhafter, weil sich da ja einer wahrlich alles erlaubt und wie kaum ein anderer dieser hier verhandelten Männer in Serie, bitter dafür zu zahlen bereit ist. Völlig unbekümmert.
CHRISTOPH: Danny McBride als archetypisch egomanischer Strizzi (eine der vielen gnadenlos guten Selbstbeschreibungen: „The Man With The Golden Dick“) mit ausgewachsenem Gottkomplex und rausgewachsenem Nackenhaar ist womöglich die lustigste Will-Ferrell-Figur, die der als Producer eh auch involvierte Meister selbst nie gespielt hat. Zumindest in den ersten beiden, noch sattsam und ohne Reue im Irrsinn stampfenden Staffeln halt. Die lassen sich aber mit einem Kenny-Powers-Frisurenvergleich ganz gut preisen: vorne schneidig, hinten Party.
Eine kleine Warnung: Wer bereits im Teil Eins dieser Gespräche, die sich um strauchelnde Existenzen wie Don Draper oder Walter White drehten, den feministischen Anteil etwas vermisste, wird diesmal wohl vollends verzagen. Denn bei den meisten der Serien, die wir uns heute vorgenommen haben, buberlt es gewaltig, der strenge Geruch der Männlichkeit steht im Raum. Wir bitten inständig um Verzeihung.
CHRISTIAN: Apropos Will Ferrell, der Mann hat ja in der Serie, von der ich bislang leider nur die erste Staffel kenne, auch die bösestem Auftritt seiner ansonsten mit Manifesten des Humanismus gespickten Karriere. Vor diesem fiesen Autohändler, den er da gibt, habe ich echt ein bisserl Angst. Spitzenserie jedenfalls.

HBO
CHRISTOPH: Kommen wir zum unter all den einschneidenden Serienereignissen der letzten Jahren für mich rohsten, ungestrecktesten, eindringlichsten Stoff (um bei den Metaphern unserer ersten Diskussionsrunde zu bleiben). Das dem kongenialen Geist des Elmore Leonard entsprungene „Justified“ wird trotz dreier exzeptionell guter Staffeln unverständlicherweise immer noch unter Wert verkauft, ist aber eben auch ein ganz essentielles Seherlebnis.
SEBASTIAN: Unbedingt. Ich kann mich noch zu gut daran erinnern, wie ich hier alleine schon den großartigen Pilotfilm von „Justified“ förmlich aufgesogen habe und damals mein Glück kaum fassen konnte. Da schien plötzlich alles ineinanderzugreifen, worauf ich tapfer, im jahrzehntelang dem Jungskino frönen, hingearbeitet hatte. Genauso muss sich das wohl in den 60ern angefühlt haben, als man zum ersten Mal einen Film mit Clint Eastwood sah. Ganz unvorbereitet. Weil natürlich ist „Justified“ für das Jetzt des Jungskino ein ganz ähnlicher Evolutionsschritt. Ein wohlüberlegter, selbstbewusst kluger Schritt zudem allemal. Wortreich derart verdammt auf den Punkt geschliffen, öffnet er dem Hinterland die Tore. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

FX Channel
CHRISTOPH: Insbesondere auch als chronistische Bestandsaufnahme jenes abgehängten Amerikas, in dem im staubigen Hinterland befeuert von der letzten noch lukrativen Triebfeder Drogengeschäft längst archaische Strukturen und damit über Generationen geschmiedete Fehden und Freundschaften, Loyalitäten und Vereinbarungen gegenüber (rechts)staatlichen Interventionen – in Persona des Marshals Raylan Givens (der unangefochtene King of Cool: Timothy Olyphant) – die Kontrolle übernommen haben. Nur konsequent, dass eben jener Gesetzeswächter als „very angry man“ gilt: schließlich steht so gut wie jeder seiner Gesprächspartner knietief im Kriminal – der Jugendkamerad, das Panscherl, der Vater sowieso.
SEBASTIAN: Gerade Dank jenem Jugendkamerad, von Walton Goggins, der einem zuvor schon in der wundervoll testosteron-schwangeren Serie „The Shield“ auffallen konnte, mit unaufgeregter Größe hier jetzt noch viel heller strahlend dargebracht, wird deutlich, was „Justified“ im scheinbar engen Rahmen einer Nemesis/Männerfreundschaft-Jungskino-Struktur alles nochmal ganz neu aufblättern lässt. Da fallen mir auch wenige Erzählungen ein, bei denen die Figuren derart spannende Weiterentwicklungen durchlaufen würden. Sich diese Helden (oder eben das gerade nicht), in ihren Handlungen, aber eben auch den immer wieder verdammt beeindruckenden Gesprächen untereinander, derart spannend weiterbewegen würden. Toll.

FX Channel
CHRISTOPH: Gespräch ist überhaupt ein gutes Stichwort, um den unerhörten Zauber dieser Serie einzufangen. Entgegen der feuilletonläufigen und schon eher irreführenden Einschätzung, dass es sich hierbei um so etwas wie einen modernen „Western“ handeln soll, zieht „Justified“ seinen Reiz – trotz eines bisweilen exhorbitant hohen Body Counts – nämlich speziell aus den vielen einander vorgetragenen Geschichten, deren Sätze den Protagonisten hier gern mal schneller um die Ohren fliegen als all die vielen Kugeln. Wer es wie der bei aller Lakonie sehr sprachmächtige Marshal versteht, seinem Gegenüber mit einer raffinierten Story glaubhaftig klarzumachen, wo dessen Grenzen sind und wie er sich demgemäß noch am schadfreiesten aus der Affäre ziehen könnte, kann schon nicht mehr verlieren. Was „Breaking Bad“ das sorgfältig komponierte Bild ist, ist „Justified“ das in erbarmungsloser Meisterschaft geschliffene Wort. Du darfst ruhig Poesie dazu sagen.
CHRISTIAN: Ich lausche andächtig. Und freue mich auf die DVD-Box der ersten „Justified“-Staffel, die im Regal schon seit geraumer Zeit auf mich wartet.
SEBASTIAN: Bleiben wir noch ein wenig im „Hinterland“. Auch das ungeheuer populäre „True Blood“ schwelgt da ja in üppigen Tableaus. Ich bin ein wenig hin und her gerissen. Einerseits liebe ich die Chuzpe der (nach „Six Feet Under“) zweiten Alan-Ball-Serie, vor allem wie sie sich da so ganz soapig und ungehemmt in Sex und Blut wälzt. Im Gegensatz zu „Justified“, den ich ganz glaubhaft mit dem was er zeigt als auch verwurzelt erlebe, so vermittelt mir „True Blood“ aber immer ein wenig das Gefühl, da guckt einer, der sich für eigentlich soviel schlauer hält, von Außen auf diese „Hinterland“-Welt. Durchaus mit Bewunderung, ganz im Sinne von, so ungehemmt unreflektiert, hach, das wäre schon toll, aber eben stets auch mit einer gewissen urbanen Arroganz, die sich dann auch alle Freiheiten nimmt, die Dinge ein wenig hinzubiegen und (schlimmer noch) vermeintliche Leerstellen mit dann doch wieder recht politisch korrekten Botschaften auszufüllen.
CHRISTIAN: Diese Arroganz habe ich ja gar nicht empfunden bei „True Blood“ muss ich sagen. Mich haben die ersten beiden Staffeln schlicht eingesaugt, trotz einer gewissen Ermüdung gegenüber dem Vampir Thema. Aber gerade wie Alan Ball die abgedroschen Stereotypen mit im wahrsten Sinn des Wortes bissigen Kommentaren zu God’s own country spickte, amüsierte mich eine Weile köstlich.

HBO
CHRISTOPH: Ich muss dann doch auch zugeben, dass ich immer noch und immer wieder auch gern durch die Sumpfgebiete von Louisiana wate – wiewohl es mit jeder weiteren Staffel etwas zäher vorangeht.
CHRISTIAN: Das ist leider der Punkt, für mich schlichen sich in der dritten Staffel dann soviel Fantasy-Schwulst und dazugehörige Wesenheiten in die Serie, dass irgendwann Schluss mit lustig war. Du hast ja weitergeschaut, Christoph, und dir auch Staffel Vier angetan.
CHRISTOPH: Ja, und so wohltuend der so gegen alle seriösen HBO-Erzählgewohnheiten aus Southern Gothic, Slapstick und „Sturm der Liebe“ zusammengekippte Cocktail zu Beginn auch war – zuletzt wirkte er doch etwas gar arg gestreckt. Oder, um es mit einer der Zirkuswelt von „True Blood“ entsprechenden Metapher zu sagen: Da wird mitunter mit viel zu vielen Bällen jongliert und dabei gern mal übersehen, dass da auch einige faule Äpfel durch die Luft fliegen. Am prickelndsten scheint mir die Serie dann, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenz der Vampirgeschichten besinnt – und im speziellen, wenn sie den meist reizvolleren Nebenfiguren genügend Platz einräumt. Also etwa wenn einem Russell ungebremst eine seiner Hasspredigten entgegen schleudert, Pam von allzu viel menschlicher Blödheit once again genervt die Augen rollt oder sich sexy Jessica einige Bluttropfen von den Lippen leckt.
CHRISTIAN: Die umwerfende Jessica und einige der mondänen männlichen Vampirfürsten waren für mich der letzte Grund, in die „True Blood“-Sümpfe hineinzutauchen. Aber als dann Elfen auftauchten, habe ich aufgegeben. Elfen sind in jedem Genrebereich immer das Schlimmste.

HBO
CHRISTOPH: Wie sich solch eine ausufernde Fantasy-Welt wesentlich zwingender umsetzen lässt, könnte man sich denn auch gleich bei den Kollegen aus dem eigenen Hause abschauen, beim derzeitigen (nicht nur) HBO-Übererfolg „Game Of Thrones“. Mit einem irrwitzigen Figurenaufgebot, das selbst jenes von „The Wire“ wie das eines intimen Kammerspiels dastehen lässt, wird hier ein so hochkomplexes wie herrlich mitreißendes, dabei oft sogar unvermutet grimmiges Vergnügen aufgetischt.
CHRISTIAN: Jetzt komme ich dann bald nicht mehr aus. Meine Vorurteile reduzierten sich, wie bei manch anderen auch, am Anfang natürlich auf ein Wort: Fantasy. Ich habe und will nie Tolkien lesen, wiewohl ich die „Lord Of The Rings“-Filme durchaus passabel fand. Ich mag Schlösser, Pferde, Barbaren und Schwerter in der Kombination nur bedingt, von Elfen gar nicht zu reden.
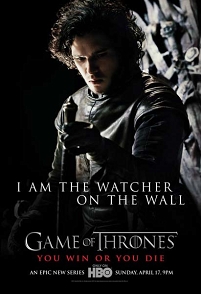
HBO
CHRISTOPH: Ich verstehe natürlich alle, die wie du, Christian, noch ein wenig zaudern, in diese Welt einzutauchen. Mir ging es anfangs durchaus genauso. Man ist bisweilen ja schon abgeschreckt von all den etwas durchgerockten Typen, die einem da auf dem Weg zur nächsten Rollenspiel-Convention mit George R. R. Martin-Paperbacks im Zug gegenübersitzen. Schließlich kann und soll man das große Geek-Geraune aber gern beiseite schieben. Diese ständig auf Zug und höchstmöglichen Spannungseffekt hingeschriebenen Geschichten würden auch in einem gänzlich anderen Setting funktionieren, ganz ohne den (ohnehin sehr dezent eingesetzten) Fantasy-Klimbim. Mehr als perfekt umgesetztes Unterhaltungsfernsehen ist „Game Of Thrones“ allerdings nicht: Wer sich eine wie auch immer geartete Metaebene erwartet, dürfte eher enttäuscht werden. Es spricht aber auch für die Qualität des Materials, dass einem dies erst reichlich spät auffällt.
SEBASTIAN: Ich will mich diesem Spiel alsbald auch einmal hingeben. Mich triggert da besonders dieses regennass knietief durch tief-schwarzen Schlamm waten, das mich da aus einigen der ersten Bilder, die ich sah, anspringt. Müde Krieger mit blutigen Schwertern, Könige, die ihre Seele in Schwarz tauchen mussten, um an die Macht zu gelangen, die sie nun unweigerlich von innen zerrfrisst. John Milius „Conan“ eben, oder vielleicht zumindest noch ein „Ironclad“ in Serie. Geht das auch nur ansatzweise in diese Richtung, bin ich an Bord.

HBO
CHRISTIAN: Ich bin jetzt auch von „Game Of Thrones“ angefixt. In meinem nächsten Leben oder hoffentlich schon viel früher, werde ich da wohl einsteigen. Und obwohl wir hier umfangmäßig schon jeden Rahmen sprengen, muss ich abschließend doch nach einem letzten Serien-Geheimtipp fragen.
CHRISTOPH: Auch wenn es beim Reden über Serien wenig weniger Aufregendes gibt sich als über deren Sender-Herkunft auszutauschen, sollte man vorwegschicken, dass jener Mann, der einst als Chief Executive von HBO den neueren Serien-Boom maßgeblich mitgestaltet hat (Chris Albrecht heißt er), nun in seiner neuen Funktion als Chefchecker beim aufstrebenden Kabelkanal Starz weiterhin auf der Mission Qualitäts-TV unterwegs ist. Davon zeugt neben der letzten Herbst angelaufenen, beklemmenden Polit- und Machtstudie „Boss“ auch der Serienneuling „Magic City“.
CHRISTIAN: Worum geht es da?
CHRISTOPH: Um ein mondänes Hotel im Miami der frühen sechziger Jahre, das dessen von Jeffrey Dean Morgan gespielter Betreiber gegen alle möglichen Unwägbarkeiten wie Finanzkalamitäten, Mafiaverwicklungen und Gewerkschaftsstreiks neben noch ganz anderer Leichen im Keller seiner Familie (zu der als Zweitfrau auch Ex-Bond-Girl Olga Kurylenko gehört) über Wasser zu halten versucht.
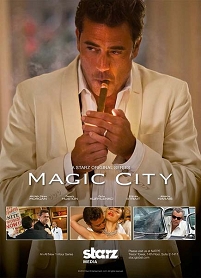
Starz
CHRISTIAN: Okay, soweit, so gut. Mit der großen Olga Kurylenko bin ich auch fast schon an Bord.
CHRISTOPH: Etwaige im Vorfeld ob der gediegenen Retro-Ausstattung ins Spiel gebrachten Vergleiche mit „Mad Men“ führen recht bald ins Leere. Vor allem die von Danny Huston mit Faible für die schillernden Reize des Outrierens und Overactings verkörperte Gangster-Nemesis transformiert die Handlung vom Feld der edlen Gesellschafts- und Zeitgeiststudie fließend in die schmierig schönen Gebiete des Pulp.
CHRISTIAN: Klingt super. Leider bin ich an der ähnlich angekündigten „Boardwalk Empire“-Saga trotz Scorsese, Michael Shannon und Paz de la Huerta nach fünf Folgen gescheitert, mich hat die Story einfach zu gelangweilt und irgendwie konnte ich kaum Identifikationsfiguren ausmachen, was gerade beim Serienwunder für mich essentiell ist.
CHRISTOPH: Man muss sich „Magic City“ als eine Art verdichtete Version von „Boardwalk Empire“ vorstellen: kein boredtalk, bloß ein empire von immer noch mehr dirt, der sich da nach und nach unter anderem in Form von Blutschlieren im Hotelpool breit macht.
SEBASTIAN: Vielleicht steuern wir unweigerlich genau drauf zu: auf den großen blutverschlierten Tod im Pool des Serien-Überfluss. Ja, man wünscht sich da fast, er möge einen tatsächlich am Grund eines solchen türkis-weißen Pools ereilen. Eines dieser Pools, an dessen Oberfläche einzt Wildenten Tony Soprano schon in die Knie zwangen. In einem dieser leeren Florida Pools, in denen Dexters Nemesis in der ersten Staffel seine Blutskulpturen aufrichtete. Im großen Vorstadt Familien-Pool, aus dem Walter White, mit versteinertem Gesicht Flugzeugtrümmer fischt. Nur um dann im ewigen Serienkreislauf erneut wiedergeboren zu werden, wie einst Patrick Duffy unter der Dallas-Dusche. Verdammt, ja, ich glaube, noch zwei-drei Staffeln gebündelt aus der Box und dann ist es soweit.

Starz

