Erstellt am: 17. 2. 2012 - 16:00 Uhr
Musik/Praxis: Verlage
- www.musicaustria.at
- Die Serie Musik/Praxis
Verlage haben vor allem die Aufgabe, Werke zu verbreiten – sie übernehmen also eine vergleichbare Aufgabe wie Labels das für Aufnahmen tun. Nochmal kurz zu dieser wichtigen Unterscheidung (in Teil 1 dieser Serie wird das ausführlicher erklärt): Verlage kümmern sich um musikalische Werke, Labels um Aufnahmen von Werken.
Musik/Praxis
Rechtliche Grundlagen
Grundsätzliches zum Urheberrecht.
Coverversionen, Remix & Sampling
Die rechtlichen Grundlagen musikalischer Bearbeitungen.
Verwertungsgesellschaften
AKM, Austro Mechana und Co.
Mehr Verwertungsgesellschaften
Live Musik
Konzerte als gutes Geschäft?
Mehr zum Thema "Live"
Veranstalter, Booking-Agenturen und Steuern.
Labels
Von Plattenfirmen, Labels und Verträgen
Ein eigenes Label
Vor- und Nachteile
Vetrieb und Handel
Tonträger verkaufen
Verlage
Was macht ein Musikverlag?
Förderungen & Sponsoring
Zuschüsse und Co
Selbstvermarktung
Wie kann ich mich bzw. meine Band gut präsentieren?
Verträge
Verträge für die Interpret/innen.
Mehr Verträge
Legalitäten für Urheber (Komponisten/Texter) und Labels
Mit einem Beispiel wird das anschaulicher: angenommen, euer liebster Act 2011, James Blake, covert (Jesus Christ) "Superstar" (ich weiß auch nicht, warum mir gerade so ein albernes Beispiel einfällt, Weihnachten hinterlässt seltsame Spuren), dann wird sein aktuelles Label Polydor den Track vermutlich als Download und 12" veröffentlichen und sich um die Promotion kümmern.
Das Werk aber, welches auf die Kappe von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice geht, bleibt im gleichen Verlag, der sich seit 1970 um Aufführungen und Veröffentlichungen des Songs von unterschiedlichsten Interpreten bemüht und in dem Fall versuchen würde, einen möglichst guten Deal mit Polydor auszuhandeln, wenn diese das Werk für ein Musikvideo von James Blake verwenden wollen oder den Text in einem CD Booklet abdrucken wollen.
Der Verlag arbeitet also im Interesse der Urheber (Komponist/Texter), das Label für den Interpreten (in dem Fall James Blake).
Damit ein Verlag diese Aufgaben wahrnehmen kann, werden ihm vom Urheber eines Werkes meist sämtliche übertragbaren Nutzungsrechte an dem Werk eingeräumt, sofern diese nicht bereits von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden:
- Druck, Verkauf und Verleih von Noten- und Textmaterial: Die ursprüngliche Aufgabe von Verlagen war es Noten zu setzten, zu stechen und zu drucken und diese zu verleihen und zu verkaufen. In den Frühzeiten von Verlagen (ca. zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) war das die wirksamste Methode, um musikalische Werke zu verbreiten. Die Herstellung von Noten ist dort, wo Musik vom (Noten-) Blatt gespielt wird, also etwa in der sogenannten "Neuen Musik“, der zeitgenössischen E-Musik, noch immer ein wichtiges Thema, auch wenn sich die technischen Methoden geändert haben.
- Die so genannten "große Rechte“, das heißt die bühnenmäßige/szenische Aufführung und Sendung musikdramatischer Werke (z.B. Oper, Operette, Musical) vollständig oder in größeren Teilen und deren erstmaliges Festhalten auf CD oder DVD.
- Die Erteilung von Abdruckbewilligungen (Noten und Texte).
- Die Vergabe von Synchronisationsrechten - für die meisten Urheber eine wichtige potenzielle Einnahmequelle. Hier geht es um das Recht, die Musik in Verbindung mit Film zu verwenden – also z.B. in einem Werbespot, einem Computerspiel oder einem TV- oder Kinofilm. Ein guter Verlag sollte Kontakte zu Agenturen, Produzenten und Music Supervisors haben und sich aktiv um diesen Bereich bemühen.
- Bearbeitungen, Kürzungen und sonstige Veränderungen des Werkes (von Arrangement über Übersetzung von Texten bis zur Herstellung von Klingeltönen) sowie Werkverbindungen zu erlauben.
- Jegliche Nutzung und Bearbeitung eines Werkes zu Werbezwecken zu erlauben. Eine nicht genehmigungspflichtige Ausnahme wäre, wenn eine CD von der Plattenfirma selbst mit der darauf befindlichen Musik beworben wird.
Einige dieser Rechte werden oftmals nur vorbehaltlich einer Zustimmung des Urhebers übertragen, wie z.B. die Nutzung zu Werbezwecken und Bearbeitungen. Werden die Verwertungsrechte (Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, Aufführung und öffentliche Zurverfügungstellung) nicht von einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen, werden diese Rechte auch dem Verlag eingeräumt.
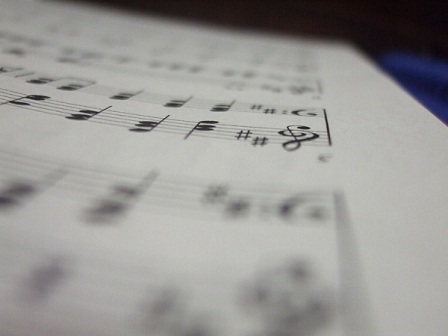
Jon... in 3D (CC)
Weitere Aufgaben eines Verlags, die sich nicht direkt aus diesen Rechten ergeben, wären die Überprüfung der Abrechnungen von Verwertungsgesellschaften im In- und Ausland und eventuelle Vorauszahlungen. Diese werden immer seltener und werden nur mehr bereits bekannten Urhebern gewährt. Solche Vorauszahlungen werden über die Tantiemen von Verwertungsgesellschaften zurückgezahlt, der Verlag bekommt also so lange alle meine Urheber-Tantiemen, bis die Vorauszahlung abgezahlt ist. Vorteil: Wird die Summe so nicht erreicht, muss ich das Geld in der Regel nicht aus anderen Einkünften zurückzahlen. Es ist aber davon auszugehen, dass Verlage nur solchen Urhebern Geld vorschießen, bei denen sie ziemlich sicher sind, dass sie ihr Geld auch innerhalb weniger Jahre wieder herein bekommen. Vorauszahlungen können hilfreich sein, wenn man z.B. eine Produktion vorfinanzieren muss, allerdings sollte man bedenken, dass einem dann eine Zeit lang die gewohnten regelmäßigen Einkünfte aus Tantiemen fehlen werden.
Die Überprüfung der Abrechnungen von Verwertungsgesellschaften ist eine wichtige Aufgabe, die man vor allem im Ausland unmöglich selbst übernehmen kann. Das kann aber auch nur von Verlagen gemacht werden, die internationale Partner (Subverlage) dafür haben. Und es ist natürlich für mich nur dann von Bedeutung, wenn ich auch Einnahmen, etwa aus Airplay oder Live-Austritten aus dem Ausland zu erwarten habe.
Was bekommt ein Verlag für diese Tätigkeiten?
Ein Verlag wird an den Urheber-Tantiemen der Verwertungsgesellschaften beteiligt und bekommen Anteile an den Einnahmen aus den Nutzungerechten, die er selbst wahrnimmt. Bei den Verwertungsgesellschaften gibt es Verteilungsbestimmungen, nach denen sich üblicherweise auch die Aufteilung zwischen Urheber und Verlag richtet.
Bei der AKM ist die Aufteilung fix: 1/3 für den Verlag, 1/3 Komponist, 1/3 Textautor (gibt es keinen Text, bekommt der Komponist 2/3). Bei der Austro Mechana kann man die Aufteilung frei vereinbaren, allerdings nur bis zu gewissen Grenzen. Üblich sind 40% für den Verlag (max. 50% in Sonderfällen), 30% Komposition, 30% Text (ohne Text 60% für den Komponisten). Wird keine besondere Aufteilung vereinbart, kommt dieser Schlüssel zur Anwendung.
Für sonstige Einnahmen aus der Verwertung der vertragsgegenständlichen Werke, die der Verlag selbst wahrnimmt, wie z.B. der Vergabe von Sync-Rights für Film oder Werbung, wird der Verlag in der Regel mit 50% beteiligt. Die genauen Beteiligungen des Verlages werden in Verlagsverträgen geregelt.
_body.jpg)
kylemac CC
Wie sieht ein Verlagsvertrag aus?
Deals mit Verlagen werden entweder für bestimmte Titel abgeschlossen (Titelvertrag) oder für alle Werke, die im Vertragszeitraum von den Urhebern geschaffen werden (Autorenexklusivvertrag). Einen kostenlosen Mustervertrag findet man auf der Seite des mica.
Auch wenn ein Verlagsvertrag oft nur für ein paar Jahre abgeschlossen wird, werden die Rechte an den vertragsgegenständlichen Werken so gut wie immer bis zum Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist eingeräumt, das heißt bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. So eine Vereinbarung muss also sehr gründlich überlegt werden. Bei kleineren Indie-Verlagen ist es allerdings durchaus möglich, sowohl dafür kürzere Fristen auszumachen, wie auch geringere Beteiligungen zu verhandeln. Der Spielraum für die Verhandlung der Konditionen hängt natürlich auch von den tatsächlichen (vor allem finanziellen Vor-) Leistungen des Verlags ab.
Aufpassen muss man vor versteckten Vertragsvereinbarungen, z.B. in Verträgen mit Labels, Studios oder Managern. Es kommt leider oft vor, dass Musikern Verlagsverträge beinahe aufgezwungen werden, von Firmen, die meist gar nicht in der Lage sind, die Aufgaben eines Verlages auszuüben. Hier wird immer wieder versucht, ohne Gegenleistung an Tantiemen mit zu verdienen. Es kann ja durchaus Sinn machen, einem Label auch die Verlagsrechte zu geben (das Label kann dann etwa mehr in Promotion investieren), aber das sollte nicht automatisch passieren und muss offen besprochen werden. Der Partner muss in der Lage sein, seine Aufgaben als Verlag vernünftig wahrzunehmen.
Einmal mehr empfiehlt es sich, seine Verträge immer prüfen zu lassen, zum Beispiel kostenlos im mica.
Braucht jeder Urheber einen Verlag?
Mit Sicherheit nicht. Aber es kann in vielen Fällen Sinn machen. Werden meine Werke viel international gespielt und aufgeführt, sollte mir ein Verlag zu Mehreinnahmen verhelfen können. Kann ich einen Vorschuss brauchen und kann ihn von einem Verlag bekommen, ist das wie ein zinsloser Kredit und eine Überlegung wert. Kann mir ein Verlag glaubhaft machen, dass er meine Werke in Film & Werbung unterbringen kann, wäre das eine gute Einnahmequelle. Im Grunde ist das natürlich auch Vertrauenssache. Was auf jeden Fall niemand braucht, ist ein untätiger Verlag, der sich weder um Promotion und Verwertung kümmert, noch international vernetzt ist, um meine Rechte weltweit zu administrieren.
Wer noch mehr zum Thema Verlag wissen will, von den verschiedenen Verlagsformen bis zur Verlagsgründung, findet hier (populäre Musik & neue Musik) noch ausführlichere Informationen.
Die nächste Folge von Musik/Praxis erscheint am Freitag, den 24. Februar!


