Erstellt am: 27. 1. 2012 - 18:25 Uhr
Schönes Sterben
Natalie Brunners Freundinnen hassen Lana Del Rey. Wegen ihrem angeblichen Mangel an Authentizität, ihren geklauten Retro-Versatzstücken, vermutlich auch wegen den verdächtig voluminösen Lippen. Und sie sind wahrlich nicht die einzigen Lana-Haters. In den üblichen digitalen Klatschaustausch-Börsen brodelt er ebenfalls hoch, der giftige Zynismus gegen den schönen Shootingstar, der im vorigen Sommer aus dem Nichts kam.
„I fake it so real I am beyond fake.
And someday you will ache like I ache.“ (Hole „Doll Parts“)
Nun liegt Lana Del Reys Debütalbum vor und die Wogen der Abneigung werden sich noch steigern. Denn, soviel sei jetzt gleich verraten, von dem charmanten Lo-Fi-Bonus, der die junge Amerikanerin anlässlich ihrer selbstgebastelten Youtube-Clips noch umgeben hatte, ist darauf nichts mehr zu spüren. „Born To Die“ ist High Fidelity im wahrsten Sinn des Wortes, große barocke Pop-Übersteigerung, theatralisches Hochglanz-Spektakel. Die kommerziellen Formatradios, die bislang jammerten, weil sie die minimalistische Zeitlupen-Tragödie „Video Games“ trotzdem auf und ab spielen mussten, dürfen sich jetzt über einige Pop-Pop-Pop-Muzik-Hits freuen.

Christian Fuchs
Ich muss zugeben, das rasende Tempo, in dem Del Reys wunderbares Noir-Universum mutierte und der kratzige Super-8-Flair gegen aufgepimpte Cinemascope-Dramen getauscht wurde, es macht mich auch irgendwie schwindlig. Ich hätte gerne künstlerische Zwischenphasen ausgekostet und mich auf Konzerte in mittelgroßen Clubs gefreut, anstatt der großen Hallen, in denen sie das Album vermutlich präsentieren wird.
Ansonsten gibt es hier jetzt aber kein schlechtes Wort zu lesen, ihr befindet euch in der Lana-Fanzone. Gelandet bin ich in eben dieser, wie Millionen andere Menschen, über ein ausgesprochenes Naheverhältnis zu „Video Games“, das irgendwann an eine ungesunde Obsession grenzte. Hört ihr doch mal wochenlang im Grunde nur einen Song. Die Nachfolgesingle „Born To Die“ verankerte den Bezug zu dieser jungen US-Sängerin noch tiefer. Und jetzt ist der Nachschub für uns Lana-Junkies in Form eines ganzen Albums da.
Hier sind die Notizen, die ich mir beim ersten und zweiten Hördurchgang machte. Ladies and Gentleman, Miss Del Rey auf die Showbühne bitte...

Christian Fuchs
1. Born To Die
„Feet don't fail me now, take me to the finish line“, mit diesen großartigen Zeilen der bereits omnipräsenten Single, eröffnet das Album. Das Straucheln, das Stolpern, das Stürzen, es wird sich durch die Platte ziehen.
Lana Del Rey singt wohl nicht als erste im Grunde nur von einer einzigen Sache: Dass man füreinander bestimmt ist, dass man ohne einander nicht auskommt, forever und ever, und dass einen das gleichzeitig verrückt macht und ins Grab bringt, „cause baby you’re no good for me.“
„Auf der Ebene des grenzenlosen Verlusts finden wir den Triumph des Seins wieder.“ (Georges Bataille)
Warum sich Frauen daran stoßen und sich viele Männer automatisch in die Beschützerperspektive imaginieren, ist mir allerdings nicht klar. Vom ersten Ton an, den ich von Lana gehört habe, identifizierte ich mich mit ihrem Blickwinkel, was anderes wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Als ob sich 2012 die Rollen nicht ständig und oft auch nur in einem einzigen Moment umkehren würden und Opfer sich nicht in Sieger verwandeln könnten und umgekehrt.
„Born To Die“, der Song und das Album, erzählen jedenfalls nicht von Resignation und Hoffnungslosigkeit wie etliche Indie-Jammer-Bands, sondern von der Stärke, die aus dem Sturz kommt und von der kribbelnden Spannung, die eine magnetische Anziehung verursacht. Das muss man sich auch einmal trauen, sein Debütwerk so zu nennen, das ist einerseits eine Pose, wie man sie nur aus dem Metal oder Lanas geliebtem Hip Hop kennt. Und andererseits ungebrochen beinhart, denn wie oft haucht einem eine Schmelzstimme schon aus dem Radio zu, das wir alle, früher oder später, Baby, unter der Erde liegen werden?
2. Off To The Races
Nach dem majestätischen Auftakt schraubt Lana die Melancholie einen Hauch zurück und zeigt sich erstmals von ihrer tanzbaren Seite. Rihanna schaut fühlbar ums Eck, man(n) könnte sich dazu sogar die endlosen Popowackel-Paraden des R’n’B vorstellen. Die Erzählerin in „Off To The Races“ badet sich in hedonistischen American-Dream-Visionen und Streicherensemble-Orgien, der „old man“, der besungen wird, braucht viel Geld für diverse Freizeitvergnügungen gesunder und ungesunder Natur. Hier ist sie, die in Interviews von der Sängerin immer beschworene Obsession für Rap-Lyrics, inklusive aller Bling-Bling-Klischees.

Christian Fuchs
3. Blue Jeans
Ein Song, der aus dem Netz vertraut ist, die musikalische Definition von Lässigkeit. Mit Jeansreklamen, „Natural Born Killers“ und „Badlands“ im Kopf den Highway 666 entlangcruisen, der Wind spielt in den Haaren, die Sonnenbrillen werden auch nach Anbruch der Dunkelheit nicht abgenommen. „Blue Jeans“ weist musikalisch, obwohl vollgestopft mit ikonischen Bildern aus der Rock’n’Roll-Geschichte, auch darauf hin, dass Lana Del Rey eigentlich eines der beliebtesten 90er-Jahre-Genres zurückbringt: den Trip Hop.
4. Video Games
Das Lied. Der Song. Die Hymne. Enough said.
5. Diet Mountain Dew
Nach dem Überdrama gibt es, in klassischer Oldschool-Pop-Tradition, eine flockige Verschaufpause und Futter für die großen amerikanischen Radiostationen. Wäre man böse, könnte man hier den ewigen Glattmacher Mark Ronson als Produzenten vermuten, aber der ist weit und breit in den Credits nicht zu finden. In aller fluffy Nettigkeit featured dieser Song auch die Lana-Botschaft schlechthin als Refrain: „Du tust mir nicht gut, Schatzi, aber ich will dich um jeden Preis.“ Ach, jetzt hat es mich doch gepackt.
6. National Anthem
Explodierende Feuerwerke und Strings à la „Bittersweet Symphony“ leiten eines der besten und ungewöhnlichsten Stücke des Albums ein. „Wining and dining, drinking and driving, excessive buying“ singt, nein, rappt Lana tatsächlich über einen trockenen Beat, „Money is the national anthem.“ Nach außen noch ein Track, der zur R’n’B-Liga passen würde, drinnen wohnt aber nur Leere, die pinkfarbene Konsum-Seifenblase, mit der die Protagonistin in einigen Songs kokettiert, zerplatzt hier.
„Dyin' on our drugs and our love and our dreams and our rage.“ (Lana Del Rey, "National Anthem")

Christian Fuchs
Lana Del Rey, die mit 18 zu trinken aufgehört hat und auch nicht raucht, die klug und kalkulierend von Irrationalismus und Überschreitung singt, ist auch eine Moralistin, die den Celebrity-Irrsinn ekelhaft findet und trotzdem ab und zu mal gerne in Champagner badet. Wer solche Widersprüche nicht als die Essenz des Hier und Jetzt versteht und gar anprangert, entlarvt sich selber in aller Naivität.
Bleibt angesichts des Flows der Stimme noch das Thema: Kann und darf die schüchterne junge weiße Dame im Hip-Hop-Terrain herumpfuschen? Meine Damen und Herren, these days, im Zeitalter des Castingshow-Faschismus, hat ja mitten im Mainstream nur das Patscherte, Brüchige und Unsichere noch irgendeinen Wert. Ein Kanye West zehrt nicht bloß von gigantischen Tracks, seinen Skills und der fetten Produktion, sondern vor allem auch von Momenten, wo live seine Playbacks ausfallen und mitten aus dem Autotune-Nebel eine herrlich windschiefe Stimme auftaucht. Gerade weil Lana Del Rey in Shows der Gesang versagt und sie ihre Unsicherheit nicht kaschieren kann, gerade deswegen sitzt sie dort oben, von zwei Tigern flankiert, auf dem Thron.
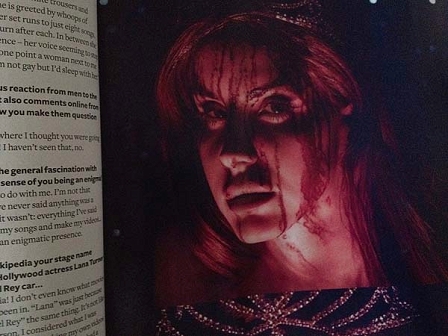
Christian Fuchs
7. Dark Paradise
Genug getanzt, Schluss mit Lustig, die Angst und die Panikattacken übernehmen wieder, Lizzy Grant, die sich Lana Del Rey nennt, steht bis zu den Beinen im Wasser, möchte nicht mehr aufwachen. „Everytime I close my eyes, it’s like a dark paradise", der Tod ist allgegenwärtig auf diesem Album, aber auch die Wiederauferstehung, nicht im christlichen Sinne glücklicherweise, das überlässt Lana der Kollegin Madonna, an die dieser Song durchaus erinnert.
Zeitlupen-Hymnen wie diese, wo Minimalismus auf Maximalismus trifft, Reduziertheit auf Bombast und es textlich vor Anstiftungen zum Selbstverlust wimmelt, sind die ganz große Stärke der Lana Del Rey. Niemand, so könnte man es auf den Punkt bringen, singt derzeit so verführisch übers Sterben. Don’t try this at home, kids.
8. Radio
Achterbahnfahrt Album. Nach einem Slow-Motion-Intro wummert ein Song aus den Boxen, der auch auf ein Album von All Saints passen würde. Sagen wir mal vorsichtig, würde Lana Del Reys Werk nur aus solchen Stücken bestehen, hätten wir es wohl nicht mit dem Hype des (Vor-)Jahres zu tun.
9. Carmen
Ah, ein uraltes Bild wird hervorgekramt, den Carmen-Mythos haben bereits Carlos Saura und Jean Luc Godard inszeniert und einige Schmerzensmänner besungen. Lana erzählt von einem mean girl, einer Frau, die kompromisslos ihren Weg des bedingungslosen Eskapismus und der flottierenden Partner und des chicen Auftakelns geht, das kann nur schlecht enden. Die tolle Ballade entpuppt sich als entfernter Verwandter von Falcos „Jeannie“, am Schluss bleiben leere Schnapsflaschen, Lügen, Leere.

Christian Fuchs
10. Million Dollar Man
Hat diesen schlichten Schleicher-Beat David Lynch himself programmiert? Ein musikalisch herrlicher Track, der vielleicht textlich ein wenig zu sehr mit den an dieser Stelle schon bekannten Klischees von Diamanten, Autos und reichen, herzbrechenden Boyfriends flirtet.
Anderseits muss man an dieser Stelle endlich mal den Authentizitäts-Polizisten auszurichten: Wie alle grandiosen Over-The-Top-Artists versteht Lana genau, was den besten Pop ausmacht - den realen, dumpfen Schmerz, diese Alltagsgefühle an der Grenze zur Depression, dieses Warten auf eine simple SMS, auf eine lächerliche Facebook-Message, diese ganze Banalität gewaltig aufzuheizen und in Las-Vegas-Glitzer zu verpacken. Ich wage zu behaupten: Wer in einer kalten Großstadt-Nacht alleine durch den Regen spaziert und sich dabei nicht manchmal wie ein melodramatischer Charakter in einem eisigen Noir-Streifen fühlt, wer sein Leben noch nie übersteigert und sich in Projektionen verfangen hat, wird Lana Del Rey nie wirklich verstehen.
Trotzdem ist so ein Übermaß an überlebensgroßen Emotionen in der Geballtheit fast too much, deshalb muss ich an dieser Stelle eine Hörpause einlegen.
11. Summertime Sadness
Nach der Ruhe knallt dieser Geniestreich doppelt rein. Streicher, Twanggitarren, Glocken, Gänsehaut, Tränen. Lana Del Rey, die in New York wohnt, bringt den „Hollywood Sadcore“ auf den Punkt, klinkt sich in die Tradition des Californian Gloom ein. Draußen im Freibad, auf dem Sportplatz und im Eissalon haben alle ihren Spaß, nur unsere junge Tragödin driftet tiefer ins Vakuum ihrer unglücklichen Liebe. Das neue „Video Games“ it is.
„Nothing scares me anymore...“ (Lana Del Rey, "Summertime Sadness")
12. This Is What Makes Us Girls
Wie klingt ein Schlusssong auf einem Album voller Schlusssongs? Vielleicht an der Oberfläche wie ein glitschiger Poptrack, der Madonna und all ihren Nachfolgerinnen stehen würde. Das Wasser des Hotelpools glitzert in der Morgensonne, Lana beschwört die eigene Jugend, ihre gute Zeit mit den Freundinnen. Keine Frage, auch hier schlummert etwas darunter, ein todtrauriger Abschied von der Unschuld und dem Spaß, ein stellenweise bitterböser Cheerleader-Grabgesang.

Christian Fuchs
„To Live And Die In L.A“ heißt ein famoser Thriller aus den 80ern, der Titel passt auch diesem Album. „Geboren um zu sterben“ ist hoffentlich nicht der zukünftige Soundtrack blutjunger Hollywoodgirls, die mit Diätpillen und Antidepressiva vollgestopft an ihren Pulsadern herumschneiden. Denn, wie uns ja das alte Katharsisprinzip lehrt, formuliert von den Pop-Vordenkern der griechischen Antike: Der zelebrierte Schmerz von anderen hilft einem die eigene Seele zu läutern und zu gesunden.
Auf die Frage eines Magazins zu ihrem typischen Zustand antwortet Lizzy Grant: „Glücklich. Und im Frieden mit mir selbst.“ Wem dieser Kontrast zur morbiden Femme Fatale Lana Del Rey zu extrem ist, der findet im Titelsong des Albums einen schönen Kompromiss. „Keep making me laugh, let's go get high, road's long, we carry on“ singt sie da. Und nicht zuletzt: „Try to have fun in the meantime.“

