Erstellt am: 2. 12. 2011 - 15:48 Uhr
Musik/Praxis: Einleitung & "Rechtliche Grundlagen"
mica – music austria ist der professionelle Partner für Musikschaffende in Österreich. Was heißt das konkret?
Musik/Praxis
Rechtliche Grundlagen
Grundsätzliches zum Urheberrecht.
Coverversionen, Remix & Sampling
Die rechtlichen Grundlagen musikalischer Bearbeitungen.
Verwertungsgesellschaften
AKM, Austro Mechana und Co.
Mehr Verwertungsgesellschaften
Live Musik
Konzerte als gutes Geschäft?
Mehr zum Thema "Live"
Veranstalter, Booking-Agenturen und Steuern.
Labels
Von Plattenfirmen, Labels und Verträgen
Ein eigenes Label
Vor- und Nachteile
Vetrieb und Handel
Tonträger verkaufen
Verlage
Was macht ein Musikverlag?
Förderungen & Sponsoring
Zuschüsse und Co
Selbstvermarktung
Wie kann ich mich bzw. meine Band gut präsentieren?
Verträge
Verträge für die Interpret/innen.
Mehr Verträge
Legalitäten für Urheber (Komponisten/Texter) und Labels
Es ist unser täglicher Job, mit Musikschaffenden zu arbeiten. Wir promoten ihre Musik und beraten sie und ihr wirtschaftliches Umfeld (also z.B. Labels, Manager, Promoter, Verlage etc.) in Karrierefragen, rechtlichen Angelegenheiten, helfen ihnen Kontakte zu knüpfen, arbeiten an Exportmaßnahmen, organisieren internationale Konferenzen und vieles mehr.
In dieser Artikelserie möchten wir die Themen behandeln, die in unseren Beratungsgesprächen am häufigsten nachgefragt werden und einen Überblick geben, welche Bereiche abseits des Musikmachens für Musikschaffende relevant sind. Wir werden versuchen, die teilweise sehr komplexen Themen einfach und verständlich aufzubereiten und wo nötig auch erläutern, wie die Dinge in der Praxis gehandhabt werden. Wer sich darüber hinaus eingehender mit einzelnen Themen befassen möchte, wird weiterführende Links oder Literaturhinweise vorfinden. Und natürlich sind alle Musikschaffenden eingeladen, die Services des mica in Anspruch zu nehmen.
Teil 1: Rechtliche Grundlagen
Jeder der Musik macht oder auch nur nutzt sollte unbedingt über ein paar rechtliche Grundkenntnisse verfügen, damit er weiß, wofür er um Erlaubnis gefragt werden muss bzw. selbst fragen muss und wofür nicht, und um zu verstehen, wie man mit Musik auch Geld verdienen kann. Steht am Anfang der Bibel das Wort, so steht analog dazu am Anfang des Urheberrechts das Werk.
Ein Werk im Sinne des Urheberrechts kann eines der bildenden Kunst, des Films, der Literatur oder eben der Musik sein. Wir behandeln hier jetzt also „Werke der Tonkunst“, das sind Tonfolgen, die eine „geistig eigentümliche Schöpfung“ darstellen und „Werke der Literatur“, also die Texte zu den Musikstücken.
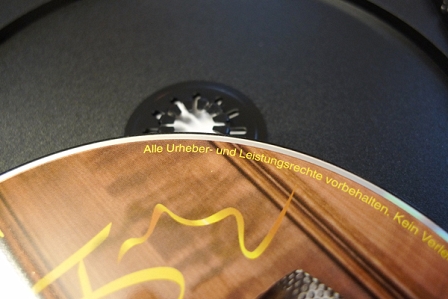
Rainer Praschak
Diejenigen, die so ein Werk erschaffen, sind die Urheber, in unserem Fall also Komponisten und Textautoren. Ihr Werk ist bereits ab dem Zeitpunkt der Schöpfung (wir bleiben in Bibelnähe) geschützt, also etwa mit dem ersten Spielen, Aufnehmen oder Notieren des Werks, es bedarf dafür keinerlei Anmeldung bei einer offiziellen Stelle. Wenn mehrere Personen ein Werk gemeinsam erschaffen, sind sie alle „Miturheber“ und haben die gleichen Rechte an dem Werk. Auch bei Bearbeitungen und Arrangements kann das Urheberrecht entstehen.
Sind in einer Band automatisch alle Mitglieder Miturheber?
Nein. Beispiel Beatles. Bei den meisten Beatles-Songs steht in Klammer (das sind die Urheberangaben) Lennon/McCartney. George Harrison und Ringo Starr waren zwar Band-Mitglieder und haben an den Aufnahmen der Songs mitgewirkt, diese aber nicht geschrieben. Es geht also um den Entstehungsprozess des Werks. Wenn ein Bandmitglied seiner Band einen fertigen Song präsentiert, den sie später gemeinsam einspielen, ergibt sich für die anderen Bandmitglieder dadurch noch keine Urheberschaft.
Was für Rechte haben Urheber? Persönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte.
Urheberpersönlichkeitsrechte schützen die „geistigen Interessen“ an einem Werk. So können die Urheber z.B. den Titel ihrer Werke bestimmen oder sich dagegen wehren, dass ihr Werk in einer Form verändert wird, die sie nicht wollen. Es darf also etwa nicht jeder x-beliebige Politiker hergehen und ungefragt einen launigen Rap zu meiner Komposition veröffentlichen, das ist schon eine wichtige Sache. Persönlichkeitsrechte können bei uns (im Gegensatz z.B. zu den USA) nicht übertragen oder verkauft werden (eine Ausnahme bietet da nur die Möglichkeit von Miturhebern, zu Gunsten anderer Miturheber auf ihre Urheberschaft zu verzichten).
Verwertungsrechte wiederum ermöglichen den Urhebern mit ihren Werken Geld zu verdienen. Es gibt fünf Verwertungsarten:
- Vervielfältigung (Aufnahme und Kopieren von Tonträgern)
- Verbreitung (Weitergabe eines Tonträgers, etwa Verkauf, aber auch Verschenken, Vermieten etc.)
- Sendung (Radio/TV)
- Öffentliche Aufführung (Live Konzert und Abspielen von Tonträgern)
- Öffentliche Zurverfügungstellung (Streaming & Download im Internet)
Will jemand ein Werk auf eine dieser Arten nutzen, so braucht er dafür die Zustimmung der Urheber.
Oftmals haben diese die Verwertungsrechte zur treuhändischen Wahrnehmung an Verwertungsgesellschaften übertragen, die in dem Fall für die Nutzung Geld verlangen, welches an die Urheber ausgezahlt wird (dazu mehr in Teil 3 unserer Serie).
Eine ganz wesentliche Unterscheidung ist nun die zwischen Urhebern und Interpreten. Wir wissen bereits, dass Urheber die Komponisten und Textautoren eines Werkes sind. Ein Interpret ist ein ausübender Künstler, der ein Werk aufführt oder vorträgt.
Welche Rechte haben Interpreten?
Interpreten haben keine Rechte an dem Werk, welches sie aufführen oder einspielen. Aber sie haben ein so genanntes Leistungsschutzrecht an der konkreten Darbietung des Werks und somit auch Rechte an der Aufnahme, an der sie mitwirken. Wird eine Aufnahme gesendet, haben sie ein Recht auf angemessene Vergütung, zu Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlicher Zurverfügungstellung müssen sie ihre Zustimmung geben. Auch die Produzenten bzw. Tonträgerhersteller (Labels) haben Leistungsschutzrechte an den Aufnahmen, für die sie das wirtschaftliche Risiko tragen, wie auch Rundfunkunternehmer und Veranstalter.
Wie lange gilt das Urheberrecht?
Für Werke bis 70 Jahre nach dem Tod des (letzten lebenden) Urhebers, für Aufnahmen momentan noch für 50 Jahre ab dem Zeitpunkt der Aufnahme, bzw. (falls gegeben) der ersten Veröffentlichung der Aufnahme. Dieses Jahr wurde eine Verlängerung auf 70 Jahre von der EU beschlossen, die innerhalb von 2 Jahren in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muss. Danach sind die Werke und Aufnahmen frei und jeder darf damit machen, was er möchte.
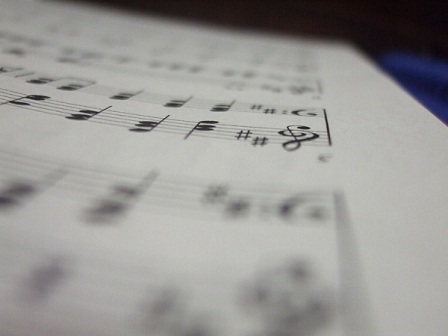
Jon... in 3D (CC)
Urheber vs. Interpret / Komposition vs. Aufnahme
Nun sind Musikern häufig Urheber und Interpreten gleichzeitig, ohne dass es ihnen bewusst ist. Deswegen erscheint ihnen auch eine Unterscheidung oftmals unerheblich zu sein. Mit dieser Einstellung werden sie allerdings leider auch allzu leicht bei Vertragsverhandlungen über den Tisch gezogen, wenn es darum geht für Rechtsübertragungen entsprechende Gegenleistungen zu verhandeln. Ein nicht unerheblicher Teil der Einnahmen von Musikern kommt nämlich aus der Verwertung ihrer Werke, oftmals mehr als aus der Verwertung von Aufnahmen.
Wenn z.B. ein Song für eine Werbung oder einen Film verwendet werden soll, müssen sowohl die Rechteinhaber an der Aufnahme, wie auch die Rechteinhaber an den Werken zustimmen und können in der Regel die gleichen Vergütungen dafür verhandeln.
Wenn ich also etwa einem Label mit den Rechten an einer Aufnahme auch gleichzeitig in einem Verlagsdeal die Rechte an dem der Aufnahme zugrunde liegenden Werk übertrage, würde ich in dem Fall auf 50% der möglichen Einnahmen verzichten. Das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht sinnvoll sein kann, mit einem Label auch einen Verlagsdeal zu machen, aber es sollte unbedingt auch eine entsprechende Gegenleistung dafür geboten werden.
Um es ganz anschaulich zu machen:
Nehmen wir einen Song her, den wohl jeder kennt, z.B. „Tainted Love“. Geschrieben wurde der 1964 von dem Songwriter und Produzenten Ed Cobb für die Sängerin Gloria Jones (diese Frau ist für die Popgeschichte mehrfach von Bedeutung, hat sie doch den Wagen gefahren, in dem ihr Lebensgefährte Marc Bolan (T-Rex) tödlich verunglückt ist), die ihn als B-Seite einer 7“ veröffentlichte. Welchen Unterschied macht es nun für eine Firma, die Rechte an der Komposition zu haben, oder die Rechte an dieser Aufnahme?
Nun, jedes Mal wenn die Nummer später in der Coverversion von Soft Cell, Marilyn Manson oder gar von Coil oder den Scorpions (!) im Radio gespielt wird oder als Tonträger verkauft wird oder von irgendeinem Interpreten live aufgeführt wird, bekommt der Rechteinhaber von Komposition und Text Geld dafür. Derjenige, der die Rechte an der Aufnahme von Gloria Jones hat, verdient nur dann etwas, wenn ihre Version im Radio läuft oder verkauft wird. Klar hat sich diese Version im Laufe der Jahre mit Hilfe der bekannteren Coverversionen besser verkauft, aber das große Geld war damit nicht zu machen.
Musik/Praxis
Am Freitag, 9. Dezember folgt der nächste Teil unserer Serie Musik/Praxis: "Coverversionen und Sampling"


