Erstellt am: 16. 2. 2011 - 18:31 Uhr
Das Recht auf Information

twentytwenty.at
Daniel Dietrich spricht am 23.2. beim Symposion "Twenty.Twenty" in Wien.
Es war erst gestern während einer Arbeitspause. Den Kopf geschüttelt haben wir, und uns echauffiert darüber, dass wir im Informatikunterricht vorwiegend mit Detailfunktionen der Microsoft-Datenbank-Software "Access" gequält wurden - anstatt, dass man uns, sagen wir, mit der subversiven Kraft von Hacking und der kommunikativen Stärke von Netzkultur erleuchtet hätte. Dennoch: Hätten Kollege Gratzer und ich damals in der Schule besser im "Access"-Unterricht aufgepasst, wären wir dank unserer Qualifikation heute möglicherweise schon mit einem Bein in der aufstrebenden Branche der Datenaufbereiter tätig.
"Das ist aber absolut nichts Neues." meint einen Tag später der deutsche Open-Data-Botschafter Daniel Dietrich im FM4 Interview. "In der Verwaltung gibt es dieses Berufsfeld schon seit Jahren. Dazu gehören auch Prozessabläufe und Mechanismen, wie persönliche Daten in Statistiken anonymisiert werden. In den Medien ist es auch nichts Neues: Informationen zu analysieren und aufzubereiten ist Kerngeschäft."

ddie.me
So gesehen sind Gratzer und ich also doch bereits für die Datenauswertung qualifiziert und im richtigen Beruf. Trotzdem, es ist etwas im Umbruch. Denn nicht-personenbezogene Daten aus der öffentlichen Verwaltung, mit denen Unternehmen, Netzwerke und Journalisten seit Jahren und Jahrzehnten hantieren, werden zunehmend freier, offener, direkter zugänglich.
- Open Government Data (Michael Fiedler)
Aufbruch der alten Verhältnisse
Wir wissen in der Regel nicht viel über die aktuelle Feinstaubbelastung in unserem Wohngebiet, die Bewegungen und Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr oder in welche Einrichtungen unsere Steuergelder fließen. Die Datensätze dazu existieren natürlich zu jeder Zeit, sind aber oft nur über Umwege oder bereits individuell aufbereitet einsehbar. Oft ist das Abrufen díeser Daten auch mit Kosten verbunden.
Im angloamerikanischen Raum sind Open Data und Open Government bereits weiter in Gesellschaft, Politik und Verwaltung verankert. Der Grund dafür sind laut Daniel Dietrich die bereits viel früher als im deutschsprachigen Raum verabschiedeten Informationsfreiheitsgesetze.
Zwei zentrale österreichische Open-Data-Plattformen sind Open3 und Open Government Data Austria.
Wo der Staat und seine diversen Verwaltungseinrichtungen meist mit wenigen Mausklicks viel über uns herausfinden können, haben wir umgekehrt wenig Einsicht in das Schaffen von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen. Ein Grund dafür ist ein altes, hierarchisches Verhältnis, das nicht so schnell aus unseren Köpfen hinaus will: das Klischee von Staat und Regierung als Kontrollinstanzen und Obrigkeit und dem Bürger als Befehlsempfänger. Auch wenn moderne, westliche Regierungen größtenteils transparente Datenflüsse und Open Government begrüßen - es schwingt dabei immer auch ein Machtverlust mit.
Früher war es vonseiten des Staates noch einfach: Die Kosten der Datenerhebung hat man sich durch den Verkauf der selbst interpretierten und aufbereiteten Daten in vielen Fällen wieder zurückgeholt. Dieses Modell gilt mittlerweile als überholt und wird zunehmend vom Open-Data- bzw. Open-Government-Prinzip ersetzt.
Kein Angst vor der Auswertung
Der Staat erhebt weiterhin die Rohdaten, denn das gehört zu seinen Grundkompetenzen. Diese Daten über Verkehr, Gesundheit, Stadtplanung, usw. sollen nun aber auch von uns allen ausgewertet werden können. Skeptiker wenden ein, dass hier die Gefahr der bewussten oder unbewussten Falschinterpretation der Daten besteht.
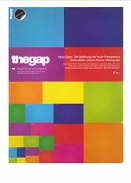
The Gap
Weiterlesen: Der Leitartikel der aktuellen Ausgabe von thegap ist Open Data gewidmet.
Open-Data-Experte Daniel Dietrich hält von diesem Argument wenig. Er spricht von der Kraft der Community, die - siehe Wikipedia - "falsche" Interpretationen und Auswertungen, schnell wieder zurechtrückt oder als unseriös abstempelt. Dass dieses Prinzip in der Praxis auch ausgetrickst werden kann bzw. durch die schiere Menge an Daten irgendwann unübersichtlich wird und die Qualitätskontrolle zumindest zeitlich nachhinkt, ist allerdings schon durch viele Fälle bestätigt worden.
Die Daten, die ich rief ...
Die Frage ist auch, ob wir als Privatpersonen, Unternehmer, Firmen und Wissenschafter schon jetzt in der Lage sind, mit einer geballten Menge an rohen Datensätzen umzugehen. Einzelpersonen haben selten die Expertise, sich da in absehbarer Zeit durchzuwühlen. Firmen mit dem nötigen Fachwissen schaffen das schon eher. Die Gefahr, dass die Privatwirtschaft hier einen neuen Markt erschließt und alle anderen leer ausgehen, sieht Daniel Dietrich aber nicht. Dafür seien die Datensätze zu umfangreich und die Möglichkeiten zu vielfältig.
"Es können verschiedene, sehr spezialisierte Dienste sein, oft ganz kleinteilige Sachen. Es wird sich irgendjemand finden, der für bestimmte Daten z.B. eine iPhone-App bastelt. Da, wo es Bedarf gibt, wird es jemanden geben, der diese Daten analysiert und aufbereitet."
Ist die schiere Menge an Daten nun Fluch oder Segen? Fest steht, dass ihre allgemeine Verfügbarkeit ein demokratiepolitischer Gewinn ist. Wie die individuellen Auswertungen ausfallen und in welcher Form sie uns zur Verfügung stehen werden, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.


