Erstellt am: 9. 9. 2010 - 14:59 Uhr
Der Anti-Sarrazin
Mark Terkessidis findet die Aufregung um das Sarrazin-Buch ja gar nicht so schlecht. Schon bei der ersten Sarrazin-Debatte, so schreibt er in einem Kurzbeitrag für den Berliner Tagesspiegel, habe man nämlich gesehen, dass bestimmte Thesen in der deutschen Debatte eben nicht mehr durchgehen, und das sei vor zehn Jahren noch anders gewesen.
Integration ist ein Konzept von gestern
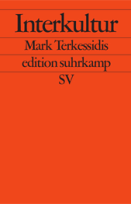
Suhrkamp
Mark Terkessdis ist Diplom-Psychologe und war in den Neunziger Jahren Redakteur beim Spex. Heute arbeitet er für taz, Tagesspiegel und die Zeit. Seine Themenschwerpunkte sind Popkultur, Migration und Rassismus.
Mark Terkessidis beteiligt sich seit über zehn Jahren am Diskurs zu Migration und Rassismus. In seinem Buch Interkultur stellt Terkessidis das ganze Konzept Integration in Frage. Denn die Diskussion um Integration stammt, genauso wie das Bild von der mulitkulturellen Gesellschaft, aus den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts; in den Jahrzehnten seither wurde zwar nur sehr wenig von dem umgesetzt, was schon damals an Integrationsmaßnahmen für MigrantInnen gefordert wurde, trotzdem hat sich die Welt weiter gedreht, und wir sind heute mit ganz anderen Bedingungen konfrontiert.
Wie früher wird ohnehin nichts mehr werden. Überhaupt stellt sich die Frage, ob es früher wirklich so schön war, wie viele es heute in Erinnerung haben. Die schöne Welt der Vollbeschäftigung war auch eine Welt, in der man Jugendliche mit den schärfsten Verhaltenszumutungen quälte; in der Frauen als kochende Gebärmaschinen fungierten, die schlecht bezahlt etwas »dazuverdienen« durften; und in der Migranten für Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt sorgten, indem sie das untere Jobsegment auffüllten und in der Krise als Erste entlassen wurden. Die Stadtplanung war vielfach ganz einfach autoritär und ging an den Bedürfnissen der Bewohner vorbei. Der soziale Ausgleich wurde erkauft durch Intoleranz (gegenüber »abweichendem« Verhalten), Ignoranz (etwa gegenüber der Umwelt) und die Ausgrenzung etwa von Migranten – genau an diesen Punkten setzten auch die »kleinen Kämpfe« der »Neuen sozialen Bewegungen« an.
Eine Gesellschaft, in der die Mehrheit einer »Minderheit« angehört
Heute scheitert man schon an der Frage, wie die einheimische Normgesellschaft eigentlich aussieht, in die sich MigrantInnen integrieren sollen. Denn mehr als "die Gesetze respektieren" und "Deutsch sprechen" kommt an konkreten Forderungen an MigrantInnen nie heraus. Selbst diverse Einbürgerungstests als Versuche, Integrationsforderungen unter dem Begriff "Kultur" weiter zu fassen, scheitern schon daran, dass sie von einem Großteil der Einheimischen auch nicht bestanden würden.
Häufig wird Integration im Alltagsverständnis als etwas betrachtet, wafür es bestimmte Standards gibt, an die sich die anderen anzupassen haben. Außerdem wird angenommen, man müsse diese anderen zur Einhaltung dieser Standards aufrufen oder gar zwingen. … Die(se) Vorstellung … geht meist einher mit der Anwendung doppelter Standards. … (Man) sorgt sich um die Geschlechtergleichheit bei den Migranten und legt dabei einen Standard an, der in Deutschland gar nicht realisiert ist.
Außerdem ist die Gesellschaft des Jahres 2010 so heterogen, dass die Forderung nach Integration, so Terkessidis, zum Kampfbegriff wird, zur Forderung, die niemals erfüllt werden kann, mit der MigrantInnen aber ständig konfrontiert sind.
Dabei leiden ja nicht nur MigrantInnen an Defiziten gegenüber dem "Normzustand": Behinderte, Homosexuelle, Menschen ohne festen Wohnsitz, Arbeitslose, Fahrradfahrer, Alte, Kinder, Jugendliche, Frauen - de facto hat der Großteil der Gesellschaft irgendwo Defizite gegenüber der "Norm".
So kommen wir nicht weiter
Der Normalzustand einer Gesellschaft kann also, schreibt Mark Terkessidis, kein geschlossenes Konzept sein, das eine Norm definiert und Abweichler benachteiligt oder zwingt, vorgebliche Defizite auszugleichen. Nicht die, die von der Norm abweichen, müssen ihre Defizite ausgleichen, sondern die Gesellschaft muss so strukturiert sein, dass alle darin Platz haben.
Es kann nicht darum gehen, die Individuen über die Norm zu brechen oder sie unwiederbringlich einer Gemeinschaft zuzuschlagen. Das verengt den Gestaltungsraum, denn dann bezieht sich das politische Handeln nur noch auf die Festlegung von Kriterien für »integriertes« Wohlverhalten oder auf die Anerkennung von Gruppen. Es wird Zeit, sich von alten Ideen wie Norm und Abweichung, Identität und Differenz, von Deutschsein und Fremdheit zu trennen und einen neuen Ansatzpunkt zu finden: die Vielheit, deren kleinste Einheit das Individuum als unangepasstes Wesen ist, als Bündel von Unterschieden. Die Gestaltung der Vielheit muss für dieses Individuum einen Rahmen schaffen, in dem Barrierefreiheit herrscht und es seine Möglichkeiten ausschöpfen kann.
Die offene Gesellschaft
Es ist heute urbane Realität, dass Menschen verschiedener Herkunft und verschiedener Lebensentwürfe neben- und miteinander leben, und mit dieser Vielheit, so Terkessidis, muss die Politik umgehen lernen - ob sie will oder nicht, denn inzwischen hat in manchen Städten schon fast die Hälfte der EinwohnerInnen einen migrantischen Hintergrund.
Die erste Hälfte von Interkultur ist eine spannende Auseinandersetzung mit der urbanen Realität in Deutschland, die meistens fast 1:1 auf die österreichische Situation umzulegen ist. Mark Terkessidis' Argumentation ist stringent, er illustriert sie mit vielen Beispielen und ist weit weg von der abgehobenen Sprache, in der solche Diskurse oft geführt werden.
Im zweiten Teil des Buches entwirft Terkessidis Modelle, wie Politik, Firmen und Institutionen mit der gesellschaftlichen Vielfalt umgehen (lernen) können, wie gerechte Beteiligung aussehen kann. Das liest sich weniger spannend, ist aber als Handlungsanleitung sicher auch sehr gut verwendbar.
Illusionist oder weltfremder Multikultiträumer ist Mark Terkessidis jedenfalls keiner. Er ist sich bewusst, dass es eine vielfältige Gesellschaft nicht ohne Konfikte und Dissonanzen geben kann - auch nicht ohne Konflikte und Dissonanzen mit den Menschen, die immer noch an ihrem Traum von einer Gesellschaft festhalten, die es früher angeblich gegeben hätte.
Doch, wie Mark Terkessidis zur Sarrazin-Debatte im Tagesspiegel schreibt, gerade die offene Äußerung solcher Positionen macht sie bearbeitbar. Die Einwanderungsgesellschaft ist halt kein Zuckerschlecken. Allerdings wäre es erfreulich, wenn wir mal nicht über rückwärtsgewandte Krachmacher debattieren würden, sondern darüber, wie wir uns die Zukunft denn vorstellen.


