Erstellt am: 3. 9. 2009 - 11:33 Uhr
"Spiel woanders, du gehörst hier nicht her"
Rifaat "Jimmy" Tourk wurde 1954 in Jaffa geboren. Seine Profikarriere begann er 1972 bei Hapoel Tel Aviv, wo er bis zu seinem Wechsel zu Hapoel Jerusalem 1984 spielte. Sein scharfer Schuss brachte dem Mittelfeldspieler den Spitznamen "Rakete" ein.
Tourk war der erste arabischstämmige Israeli, der an Olympischen Spielen (1976 in Montreal) teilnahm und in der israelischen Nationalmannschaft (1976) zum Einsatz kam. Er schoss drei Tore in 34 Spielen.
1980 wurde er zu Israels Spieler des Jahres gewählt. 1987 beendete Tourk seine aktive Karriere bei Hapoel Jerusalem.
Nach mehreren Trainerstationen, unter anderem bei Hapoel Tayibe, der ersten arabischen Mannschaft in Israels Ligat ha'Al, wechselte er 1998 in die Politik und wurde in den Stadtrat von Tel Aviv-Jaffa gewählt.
Die Hapoel-Tel-Aviv-Legende Rifaat Tourk im Gespräch mit Jakob Rosenberg & Emanuel Van den Nest über Demütigungen auf dem Feld, raketenartige Torschüsse und seine Bemühungen um ein friedliches Zusammenleben in Israel.

ballesterer / Dieter Brasch
Wie bist du Profi geworden?Das war eigentlich ein Zufall. Ich bin in Jaffa aufgewachsen und habe in meiner Kindheit unter sehr schwierigen Bedingungen gespielt. Bis ich zwölf war, habe ich immer barfuß gespielt, weil ich mir keine Schuhe leisten konnte. Als ich 15 war, hat mich eines Tages ein Scout von Hapoel Tel Aviv beim Spielen mit anderen Jugendlichen beobachtet und mich danach gefragt, ob ich für seinen Klub spielen möchte. Ich war ganz erstaunt und habe ihm nur gesagt: "Ich bin doch ein Araber."
Der Verein war damals rein jüdisch?Genau. Der Scout war ebenfalls Jude. Beim ersten Training hat mich der Trainer zur Seite genommen und mir geschildert, was mir bevorstehen würde. Gleichzeitig hat er mich aufgebaut: "Wenn du hart arbeitest, ein guter Mensch bist und immer zuhörst, dann wirst du ein großer Spieler werden und viele Erfolge feiern." Danach konnte ich nicht schlafen. Ich dachte, ich könnte vielleicht mich selbst, aber niemals meinen Trainer enttäuschen. Und letztlich hat später alles geklappt, was der Trainer vorhergesagt hatte.
Wie hat dich die Mannschaft aufgenommen?Meine Mitspieler haben mich auch gut behandelt, von ihnen habe ich keinen Rassismus erlebt. Doch es hat kein einziges Match gegeben, wo mich die gegnerische Mannschaft nicht wegen meiner Hautfarbe und meiner Religion mit Beschimpfungen empfangen hätte. Das war sehr hart. Sie haben mich bespuckt und beschimpft: "Spiel woanders, in einem arabischen Land. Hier gehörst du nicht her!"
Wie haben dich die Fans behandelt?Von den Zuschauern kamen noch mehr Beschimpfungen. Aber ich habe gelernt, dagegen anzukämpfen. Auf dem Spielfeld bin ich immer ruhig geblieben und habe nie eine Rote Karte bekommen. Wenn mich die Gegenspieler geschmäht haben, habe ich zunächst einfach nicht reagiert. In den ersten zwei Jahren meiner Profizeit bin ich immer weinend nach Hause gekommen. Danach habe ich angefangen, mich gegen den Rassismus zu wehren, und habe aggressiver reagiert. Es war nicht möglich, die Angelegenheit auf offizieller Ebene über den Schiedsrichter anzugehen, sondern nur auf der persönlichen. Die Spieler haben mir aufgrund meiner Reaktion zunehmend mehr Respekt gezollt.
Welches Verhältnis hast du zu deinem Stammklub Hapoel Tel Aviv?Als arabischer Spieler ist Hapoel sicher die beste Adresse. Der Verein hat ausreichende Strukturen, um dich zum Star zu machen. Abgesehen vom Sportlichen sind die Fans damals wie heute großartig. Auch von der Vereinsleitung, den Trainern und Spielern habe ich nur Gutes erlebt. Seitdem ich dort gespielt habe, hat der Verein mehr Araber engagiert. Das hat einen politischen Ausgleich bewirkt.
Hat sich das auch bei den Fans niedergeschlagen? Hat Hapoel jetzt mehr arabische Fans?Ja, klar, 95 Prozent der Einwohner von Jaffa sind meinetwegen Fans von Hapoel. Kinder und Jugendliche sehen mich als Vorbild. Die Fans haben mich nicht zuletzt wegen meines Freistoßtors aus 50 Metern gegen Hapoel Jerusalem in guter Erinnerung.
Du warst der erste arabischstämmige Nationalspieler Israels. War das ein entscheidender Bruch, der zu einem verbesserten Klima zwischen Arabern und Juden führte? Was hat sich seither getan?Obwohl der israelische Staat eine rassistische Politik befördert, ist es für manche Araber möglich, Profifußballer zu werden, und zum Teil werden sie auch willkommen geheißen. Unter der Oberfläche ist der Rassismus aber bestehen geblieben. Mein selbstbewusstes Auftreten hat andere arabische Spieler motiviert, auch oben mitspielen zu wollen, und von israelischer Seite mehr Akzeptanz hervorgerufen. Die Einberufung ins Nationalteam und das Tor aus 50 Metern waren sicherlich wichtige Faktoren für eine verbesserte Situation gegenüber arabischen Spielern. Dennoch kann ich eigentlich keinen entscheidenden Bruch festmachen.
Wie schlägt sich der Nahostkonflikt auf den Fußball nieder?Immer, wenn es in der Politik problematisch wird, werde ich als Araber kategorisiert. Dann wird geleugnet, was ich geleistet habe. Politische Veränderungen können viel Einfluss auf den Sport und das Alltagsleben nehmen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1986 spielten, waren in einem Heimspiel zwei arabische und neun jüdische Spieler für die Nationalmannschaft auf dem Platz. Die beiden Araber haben in der ersten Halbzeit gemeinsam drei Tore gemacht. Zwei Tore habe ich, das andere mein einziger arabischer Kollege Zahi Armeli geschossen. Meine Geschwister sind damals im Publikum gesessen und haben mir nach dem Spiel erzählt, dass einige Zuschauer gemeint hätten: "Wir verlieren lieber, als dass uns die Araber zum Sieg schießen." Aber natürlich darf man solche Reaktionen nicht verallgemeinern. Das war nur ein Teil der Leute. In Bezug auf Rassismus habe ich zu viel erlebt, um jetzt alles erzählen zu können. Gleichzeitig vergesse ich auch nicht, dass sehr viele Leute, auch genügend Juden, auf meiner Seite gestanden sind und mir geholfen haben.
Wie zeigt sich diese Solidarität?Einmal hat mich ein Gegenspieler angespuckt. Obwohl es alle gesehen hatten, gab es keinerlei Reaktion auf dem Spielfeld. Am nächsten Tag haben mir der Verein und meine Mannschaftskollegen einen großen Blumenstrauß in meiner Lieblingsfarbe Rot geschenkt. Dafür war ich sehr dankbar. Wenn man sich die Situation in Israel anschaut, kann man zu dem Schluss gelangen, dass das Glas nicht einmal mehr halbvoll ist, sondern nur noch ein einziger Schluck drinnen ist. Aber genau den sehe ich. Ich unterscheide zwischen Individuen, mit denen ich gerne zusammen bin und arbeite, und der Politik, die leider rassistisch ist.
Weitere Texte aus ballesterer Nr. 45 ab sofort österreichweit im Zeitschriftenhandel.
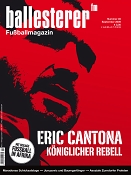
ballesterer / Dieter Brasch
- Sie nannten ihn König. Der lange Weg vom Vagabunden zur Krönung in Manchester
- "Er war einfach anders" ManU-Fanoriginal Pete Boyle singt Loblieder auf "Eric The King"
- Maradonas Zwischenbilanz - Floh Messi und Hexe Verón sollen’s richten
- Favoritner Familienkrach Seit den Hausverboten hängt bei der Austria der Haussegen schief
- Groundhopping Baustelle Hafnarfjörður, Hexenkessel Mosambik
- Kurzpass - Besungenes Familienglück, Horner Mikrofonierung, Krach in East London
- Kump - Auf Augenhöhe mit den Färöern
Seit einigen Jahren spielt der FC Bnei Sachnin erfolgreich in der Ligat ha'Al. Welchen Einfluss hat es, dass eine Mannschaft aus einer arabischen Stadt in der ersten Liga mitmischt?Es ist eine arabische Stadt, aber in Sachnin spielen auch viele jüdische Spieler. Die arabischen Mannschaften und ihre Fans akzeptieren die jüdischen Spieler auch. Umgekehrt ist es da oft deutlich schwieriger. Ich fürchte auch, dass es am Rassismus wenig geändert hat, dass mit Sachnin und Nazareth jetzt zwei arabische Teams in der ersten Liga spielen. Die Leute in Israel mögen die arabischen Mannschaften oft nicht. Aber wir spielen trotzdem.
Wie äußert sich der Rassismus?Da gibt es viele Beispiele. Ende Mai hat Beitar Jerusalem, das für seine rassistischen Fans bekannt ist, den Cup gewonnen. Bei der Pokalübergabe hat der Spieler Amit Ben-Shushan in den rassistischen Gesang der Fans gegen den arabischstämmigen Nationalspieler Salim Toama eingestimmt (das Lied endet mit den Zeilen "Ich hasse dich, Salim Toama. Ich hasse alle Araber", Anm.). Das kann doch nicht sein, dass ich auf der rechten Seite spiele und meinem Nationalmannschaftskollegen, der auf der linken Seite spielt, vor laufender Kamera bei der Siegeszeremonie ausrichte, dass ich ihn hasse.
Welche Reaktionen hat es auf den Vorfall gegeben?Gar keine. Eigentlich wäre es die Aufgabe des Fußballverbands, dagegen vorzugehen, aber er hat genauso wie der Rest des Landes gar nichts getan. Ich war der Einzige, der dann etwas zu dem Vorfall geschrieben hat. Ich habe analysiert, dass das nicht das Problem der Fans oder des einen oder anderen Spielers ist, sondern des Verbands, der derartige Dinge regeln muss. Ich frage mich, wo der Verband ist. Wo sind die Funktionäre, der Nationaltrainer – wo? Er hat zwei Spieler, einen Juden und einen Araber, und der eine will den anderen töten. Und für dich? Normal, das ist doch gar nichts. Wenn das Gegenteil vorgefallen wäre, wäre das das Ende der Welt.

ballesterer / Dieter Brasch
"Ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme"
2000 gründete Rifaat Tourk die "Association for Sports, Culture and Education in Jaffa". Das Sozialprojekt soll Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen in Jaffa unterstützen, wo 46 Prozent der jugendlichen Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Tourk bezieht die Motivation für das Projekt aus seiner eigenen Karriere: "Ich habe es mit Hilfe des Fußballs geschafft, obwohl ich als Kind keinerlei Unterstützung erfahren habe. Weil ich nicht vergesse, wo ich herkomme, möchte ich den Kindern jetzt das geben, was ich in meiner Kindheit selbst dringend gebraucht hätte."
Derzeit nutzen rund 150 Kinder und Jugendliche die Ausbildungs- und Freizeitangebote des Zentrums. Diese reichen von Lernhilfen für Schulkinder über Universitätsstipendien und Computerschulungen bis zu Theaterkursen, Fußballtraining und Matchbesuchen. Daneben werden soziale Leistungen wie ein Gratis-Mittagessen und eine Ferienbetreuung angeboten. Ziel der Association ist die Sensibilisierung für eine friedliche Koexistenz von Juden und Arabern in Israel.
Seit sechs Jahren kommt eine Reisegruppe von circa 30 Kindern jeden Sommer auf einen Kultururlaub nach Wien. Die von der Stadt Wien geförderte Reise kann ein wichtiger Antrieb für die Arbeit im Zentrum sein, meint Tourk: "Die Kinder engagieren sich das ganze Jahr besonders, weil sie auf ein Ziel hinarbeiten können. Für sie ist es ein Traum, diese Reise anzutreten. Und die kulturellen Eindrücke, die sie hier bekommen, ändern ihr Leben."


