Erstellt am: 7. 5. 2009 - 16:20 Uhr
Paralleluniversum Web 2.0
Den Begriff Web 2.0 hat vor fünf Jahren der Journalist Dale Dougherty erfunden. Er mutmaßte einen Bruch zwischen dem WWW vor Platzen der "Dotcom Bubble" im Jahr 2000 und dem "Mitmachnetz" danach. Ganz so stimmt das natürlich nicht: Das Internet war auch schon vor dem World Wide Web - in den 80er und 90er Jahren - für's Networking und zum Selbermachen da. Heute sieht man das nur deutlicher - dank schlau programmierter Plattformen und Interfaces, die verhältnismäßig einfach zu bedienen sind und zur flotten inhaltlichen Mitgestaltung beitragen.
Auch im Supermarktprospekt wird elektronisches Spielzeug jetzt als "Web 2.0 kompatibel" beworben. Was das genau heißt, wird nicht gesagt. Web 2.0 wird als irgendso ein "Netz zum Mitmachen" gesehen, und Videokameras verkaufen sich mit Youtube-Pickerl eben besser.
Angesichts der vielen Videoplattformen und Torrent-Tracker werden von politischer Seite auch mehr Forderungen laut, Filtersysteme, regionale Internetsperren oder Zugangssperren für User einzuführen. Der Philosoph, Internet-Serviceprovider und Bürgerrechtler Hans Zeger analysiert die Entwicklung des "Web 2.0" in seinem neuen Buch: "Paralleluniversum Web 2.0: Wie Online-Netzwerke unsere Gesellschaft verändern".
"Persönlich ärgert mich, dass die offizielle Diskussion über Web 2.0 eigentlich immer mit erhobenem Zeigefinger geführt wird/", sagt Hans Zeger." Quasi als Warnung seitens irgendwelcher Behördenvertreter oder Politiker. Das ist eigentlich eine versteckte Form eines Zensuraufrufes. Die Diskussion erinnert mich an frühere Diskussionen zum Thema Comics, Kino oder Rock'n'Roll. Hier wurde genauso davor gewarnt, dass die Jugend verdorben wird, dass sie in schlechte Gesellschaft gerät und so weiter."
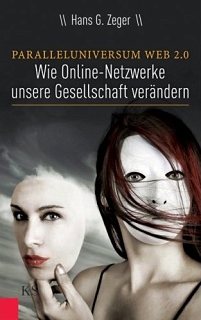
Kremayr & Scheriau
Zegers Buch ist aber nicht nur ein Apell gegen Zensur, Regionalisierung und zwangsverordnete Sperren von Usern. Vor allem fordert der Autor ein neues Denken über die Vor- und auch Nachteile digitaler Netzwerke. Denn wenn alle alles sagen können, verdrängen diejenigen, die bei der Verbreitung ihrer Inhalte am erfolgreichsten sind, diejenigen, die das weniger gut können. Wie diese Verbreitung funktioniert, haben einige wenige Firmen ganz besonders gut verstanden. Sie betreiben Blogs für ihre eigenen Presseinfos und trachten danach, diese Texte auf möglichst vielen Plattformen, die RSS-Feeds benutzen, unterzubringen - das bringt gute Ergebnisse in den Suchmaschinen. Content-Syndication heißt das Zauberwort, das dafür sorgt, dass die redaktionellen Filter von heute zunehmend ersetzt werden durch Verdrängungsfilter.
Paralelluniversum Web 2.0: Wie Online-Netzwerke unsere Gesellschaft verändern von Hans Zeger ist erschienen im Kremayr & Scheriau Verlag.
Zeger: "Ich habe als Konsument oft gar nicht mehr die Möglichkeit, zu erkennen: Was war jetzt eigentlich der Originalartikel, was ist zusätzliche, recherchierte Information und was sind schlicht und einfach nur kopierte Artikel? Wenn ich mir nur ganz oberflächlich die ersten Ergebnisse von Suchmaschinen ansehe, dann bekomme ich wahrscheinlich nur Informationen vom Hörensagen. Denn Unternehmen haben dieses System erkannt und versuchen, es zu ihrem Zweck zu nutzen. Sehr viele Unternehmen setzen nicht mehr professionelle PR-Agenturen ein, sondern schreiben sich ihre Unternehmensnachrichten selbst und bringen sie auf möglichst vielen Syndizierungsplattformen unter. Wenn dann über das Unternehmen berichtet wird und jemand steigt in die Suchmaschine ein, dann erscheint an den ersten 20, 30, vielleicht 40 Stellen immer dieselbe PR-Nachricht dieses Unternehmens, nur eben verteilt auf Dutzende Syndizierungsnetzwerke."
Schlüssel Bildungspolitik
Ein Schlüssel, diese Verdrängungsmechanismen zu durchschauen, liegt für Hans Zeger in der Bildungspolitik. Statt Frontalunterricht müsse Bildung in Zukunft darauf abzielen, dass Personen textkritisch arbeiten können. Wichtig wird es, Texte sowohl kritisch zu bearbeiten, als auch auf die Kritik anderer eingehen zu können. Die gemeinsame Arbeit soll im Web 2.0 im Vordergrund stehen, das Werk selbst, und nicht die Person. Bestes Beispiel ist für Hans Zeger das Nachschlagewerk Wikipedia:
"Wikipedia ist ein Musterbeispiel dafür, dass es möglich ist, sinnvollen Content zusammenzutragen, ohne eine zentrale Steuerung zu haben. Aus meiner Sicht funktioniert das System nur dann, wenn erstens alle User Verantwortung für das Gesamtergebnis übernehmen, und zweitens sich auch zuständig fühlen für den 'Nachbarn'. Das heißt, wir brauchen in diesen Communities einen starken sozialen Zusammenhalt, der nicht nur darauf aus ist, dass die eigene Position durchgesetzt wird - dann verbreitet man eher zweifelhafte Informationen -, sondern, dass man seine Position immer auch ein wenig zurücknimmt und auch den anderen achtet und beachtet. Das ist meiner Meinung nach eine große Herausforderung der Bildungspolitik."
Zwischendurch muten im Buch einige von Zeger eingeführte Begriffe seltsam an. Statt von Computer- oder Videospielen spricht der Autor von "Konsolspielen" (sic), dem "Paralleluniversum Web 2.0" stellt er das "Staticuniversum" gegenüber. In dieser Hinsicht bevorzuge ich ja die vom Anthropologen Tom Boellstorff eingeführte Unterscheidung zwischen "virtueller Welt" und "physischer Welt". Apropos virtuelle Welt: In Hinsicht auf Second Life begeht Zeger den häufig begangenen Fehler, von "schwindendem Interesse" seit dem Hype der Plattform im Jahr 2007 zu sprechen, während die Plattform gerade in den letzten beiden Jahren schneller gewachsen ist als je zuvor. Von solchen Fehlern abgesehen verfolgt der Autor aber den richtigen Ansatz, indem er das Spiel mit Identitäten und die Auflösung zeitlicher und räumlicher Grenzen in den Onlinenetzwerken der Gegenwart analysiert - und nachdenkt, welche Konsequenzen das für uns hat.
Grundrechtscharta Web 2.0
Hans Zeger beendet das Buch mit einer "Grundrechtscharta für das Web 2.0", die aus zehn Punkten besteht. Eine Art Erweiterung der bestehenden Grund- und Menschenrechte, die für den Autor notwendig sind, weil - wie er im Interview sagt - die Verwendung des Internet etwas anderes ist als die Verwendung einer Waschmaschine oder eines Kühlschranks:
"Hier wird sehr viel von der eigenen Persönlichkeit in einen Raum hineingetragen, der heute noch sehr schlecht reguliert ist. Diese Grundrechtscharta soll einige Regulierungen schaffen, wobei zwei Eckpfeiler wichtig sind: Zum einen soll die Meinungsfreiheit jedes einzelnen garantiert werden.
Zum anderen soll jemand, der seine Meinung geändert hat und nicht mehr will, dass er mit einem bestimmten Bild, mit einer bestimmten Aussage im Netz präsent ist, auch das Recht bekommen, dass das wieder gelöscht wird." Ein solches Grundrecht auf Löschung würde auch das Geschäftsmodell sogenannter "Reputation Manager"-Firmen ruinieren, die heute viel Geld mit der (oft nur gerichtlich möglichen) Durchsetzung der Löschung unerwünschter Texte, Bilder oder Videos im Netz verdienen.
Weitere vom Autor geforderte Grundrechte umfassen das Recht auf Schutz vor privaten Überwachern, das Recht auf unversehrte persönliche Infrastruktur oder das Recht auf den Empfang ungefilterter Information.
Hans Zeger schafft es, seine über zwei Jahrzehnte lange Erfahrung als Internet-Serviceprovider in ein Buch zu verpacken und dabei gesellschaftlich und technisch komplexe Sachverhalte auf sprachlich unkompliziertem Niveau zu vermitteln. Ein "Web 2.0" Buch, das wahrscheinlich sowohl Computernerds, als auch Mäuschenschubser gut finden können.

