Erstellt am: 11. 3. 2009 - 19:35 Uhr
Journal '09: 11.3.
Was-wäre-wenn-Geschichten, egal ob Utopien oder Dystopien, lösen in mir eine fast kindliche Lust, einen Spieltrieb aus. Nicht nur, weil sich anhand einer solchen Ausgangssituation die Gegenwart durchdeklinieren und somit durchanalsysieren lässt, sondern auch, weil die Darstellung einer veränderten Zeitlinie diesen Blick aufs Mögliche öffnet, und jede Menge Moral offenbart: dass zb nichts festgezurrt ist, nichts feststehen muss oder auch, dass es keine schwarz-weiß-Zeichnung von Welt, Mensch oder Gesellschaft gibt.
Christian Krachts Ende letzten Jahres veröffentlichte Utopie nun spielt sogar zu guten Teilen auf österreichischem Boden - dem allgemeinen Spiel(be)trieb ist das Buch mit dem schönen Titel Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten aber irgendwie entgangen. Das mag an der schwindenden Reputation von Kracht liegen, der vielleicht nur noch als ehemaliges Popliteratur-Starlet oder als Sonderling von Kathmandu (von wo aus er seinen Zeitschriften-Versuch "Der Freund" publizierte) bekannt ist - aber auch daran, dass dieser Roman in seinem Heimatland, der Schweiz, spielt, und deswegen gleich automatisch niemanden interessiert.
Zugegeben: auch bei mir liegt der bei Kiepenheuer & Witsch erschienene Roman bereits seit dem Jahreswechsel herum - und ich hab ihn erst heute gelesen. Das aber quasi mit Ansage: die Ausgangs-Geschichte ist zu interessant.
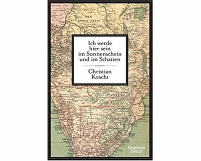
kiwi
Als Lenin nicht in den Zug stieg
Kracht lässt seine Geschichte über eine andere, nur leicht veränderte Zeitlinie der Menschheitsgeschichte am Punkt, an dem Lenin in Zürich in einen Zug zurück nach Russland steigt, abbiegen. Die Reise findet nicht statt, stattdessen wird die Schweiz zur SSR, die Eidgenossen die genossen und der große europäische Krieg tobt zwischen Deutschland und einer zb auch um viele Teile Österreichs vergrößerten Schweiz.
Dieser Krieg geht bereits über hundert Jahre, das heißt die Geschichte spielt wohl fast zeitgleich, bestenfalls in einer nahen Zukunft.
Ich behaupte einmal: wenn ein österreichischer Autor auch nur mittelklassigen Reputation etwas Vergleichbares für Österreich entwickelt hätte, wäre die Hype-Maschine der deutschsprachigen Literaturblase (die genauso oberflächlich und primitiv funktioniert wie jede andere Unterhaltungsindustrie, auch wenn sich die Verlagsszene in witziger Verblendung gerne für was besseres hält) losgerattert und hätte ein Österreich vs Deutschland-Motiv samt flächendeckender Mentalitäts-Diskussion durchgezogen, die jede Menge Aufmerksamkeit bekommen hätte. Aufmerksamkeit, die einem Buch, dass diese simplen Erwartungen dann nicht erfüllt, weil es sich dann doch an anderen utopischen Motiven versucht, nicht gerecht wird, die es aber durchaus brauchen kann - weil auch im Buchmarkt Aufmerksamkeit schon der halbe Verkauf ist.
Das alles war dem eigentlich-nicht-so-recht-Schweizer Kracht in seiner Fast-aber-nicht-ganz-Heimat Deutschland nicht vergönnt. Irgendwie ging die schöne, leise erzählte Provokation also unter.
Der Akt gegen die Geschichte
Dietmar Dath lobte in der FAZ das "kontrafaktische, dezidiert antihistorische", den Größenwahn, den ein solcher Akt "gegen die Geschichte" in sich trage.
Eh. Und auch wenn ich dann ein wenig lächeln muss, dass sich bei Kracht die von Lenin (auf der Basis von Marx) befreite Schweiz dann auch mit einem russischen Begriff (dem Sowjet) behelfen muss (warum sollte sie?), anstatt einen anderen, historisch ebenso pfiffigen Begriff dieser Tage (die Räte) zu verwenden - die mögliche Entwicklungs-Linie ist hochinteressant gezeichnet.
Mir ein wenig zu sehr nach der verraucht-verschmutzt angetretenen literarischen Vormundschaft von 1984, das wiederum stark am Topos des 1. Weltkriegs hing - aber die Prolongierung des ewigen 100jährigen Krieges darf als Grund dafür herhalten, warum sich die von Kracht gezeichnete Gesellschaft technologisch, wissenschaftlich und sprachlich nicht bewegt hat, sondern zurückschreitet.
In diesem an die Monotonie der ebenfalls in 1984 gezeichneten Pseudo-Kriege der drei Hegemonialmächte gemahnenden Schlachtengemälde bewegt sich ein Schweizafrikaner, kein Secondo, sondern ein in Afrika geborener Schwarzschweizer als teetrinkenden Polit-Kommissar, als einer der wenigen, die noch schreiben können, zwischen Ost-Afrika, Neu-Bern und Schweizerisch-Salzburg, in einem inhaltlich ausgedörrten Reich zwischen Grenoble und Klagenfurt, das ohne dem "bourgoisen Konzept einer Hauptstadt" auskommen kann.
Schweizerisch-Salzburg
Kracht zeichnet eine mögliche Parallel-Realität, die ohne Rücksicht auf die neue Welt entstanden ist, und so letztlich alle Themen, die uns in der hiesigen Realität beschäftigen, ausblendet. Also alles, was mit technologischer Entwicklung, evolutionären Prozessen, Digital-Welten, Globalisierung und komplexer Community-Entwicklung zu tun hat. Was uns, sofern wir Bewahrer des reinen europäischen Erbes und Gegner des US-amerikanischen Einflusses sind, auf niedliche Art eine böse kleine Denkaufgabe mit auf den Weg gibt.
Trotzdem frag ich mich, was ein bösartiger, hinterfotziger Österreicher aus dieser gewitzten Grund-Idee gemacht hätte. Vielleicht kein besseres Buch, aber doch mehr als nur eine somnambule Erscheinung, die sich schnell und fahrig wieder hinlegt, nachdem sie kurz durch das Feld der Aufmerksamkeit gegeistert ist.

