Erstellt am: 5. 10. 2013 - 11:00 Uhr
"Das Geschäft mit der Musik"
Berthold Seliger betreibt seit 25 Jahren eine Konzertagentur. Er ist Europaagent für Künstler wie Calexico, Lambchop, Pere Ubu, The Residents, Tortoise und viele andere mehr. Als deutscher Tourneeveranstalter arbeitet er unter anderem mit Bonnie "Prince" Billy, Bratsch, Julie Delpy, Lou Reed, Silver Jews, Patti Smith, und Youssou N'Dour zusammen.
Ab und an schreibt er über musik- und kulturpolitische Themen, berühmt-berüchtigt ist sein Newsletter, in dem er regelmäßig und meist zu Recht über Gott und die Welt, den Kapitalismus, die allgemeine Verblödung im Musikjournalismus und die Medienbranche wettert. Diesen Monat erscheint nun sein Buch "Das Geschäft mit der Musik. Ein Insiderbericht" beim Tiamat Verlag.
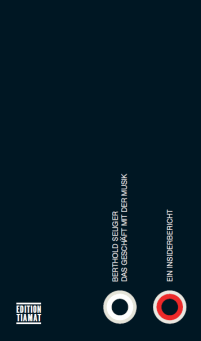
Edition Tiamat
In diesem Buch geht Seliger auf 352 Seiten auf nahezu alle Aspekte des Musikgeschäftes ein und erklärt nebenbei, wie das Tourneegeschäft, die Plattenfirmen, das Copyright oder die Gema so funktionieren. Einige der Tatsachen, die er in seiner scharfen, aber sachlichen Abrechnung mit der Musikbranche nennt, dürften popmusikaffinen Menschen bereits bekannt sein: Dass in der Musikbranche, die nur noch aus drei multinationalen Konzerne besteht, nicht nach künstlerischen, sondern rein kommerziellen Gesichtspunkten entschieden wird und dass sich die Künstler als wichtigstes und zugleich schwächstes Glied dieser Wertschöpfungskette ausbeuten lassen müssen.
Der Neoliberalismus ist nun mal längst in der Musikindustrie angekommen, nur noch wenige Global Player kontrollieren den Markt und füttern das Publikum, so Seliger, mit "kulturellem Einheitsbrei". Er bezichtigt den einstigen VIVA Chef, Popkomm- Erfinder und Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Musikindustrie Dieter Gorny der dumpfen Propaganda, weil Gorny immer wieder allein die Internetpiraterie für die Krise seiner Branche verantwortlich macht und die Konsumenten kriminalisiert, anstatt die Fehler der Industrie, die die Digitalisierung verschlafen hat, aufzuarbeiten.
Seliger hat seinen Adorno, Benjamin, Bourdieu, Žižek und Diederichsen gelesen und plädiert für eine selbstbestimmte Kunst, die nach anderen Kriterien bewertet werden soll, als Verkaufszahlen. Er erklärt, wie es anders gehen könnte, wenn nicht alle Bereiche des Musikgeschäftes von Großkonzernen dominiert würden. Die Konzentrationsprozesse im Live-Geschäft, in dem er selbst tätig ist, hätten dazu geführt, dass zwei oder drei Konzerne das Geschäft unter sich aufteilen. Die Folge ist, dass "Konzerte nicht als kulturelle Ereignisse, sondern als privatisierte Lifestyle-Zugabe zu bereits getätigtem Konsum" inszeniert werden".

Christiane Rösinger
Und früher war eben auch alles besser: "Die Konzerte und Festivals fanden im Geiste der Kommune, im Geist der Gleichheit statt", schreibt er. "Und: es gab keine Werbung, nirgends. Keine Logos von Konzernen, keine schrill ballernde Werbung, kein Sponsoring, kein Flyermüll." Wer die sponsorenfreie Zeit in den Achtzigern und Neunzigern mitgekriegt hat, dem erscheint das heutige Open Air-Event-Geschäft in der Tat als reine Werbemaßnahme für verschiedene Produkte, bei der die Musik nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Aber die jüngeren musikbegeisterten Festivalbesucher nehmen das Zugeballert-Werden mit Werbung unter Umständen gar nicht mehr als negativ war.
Seliger glaubt, dass kleine, unabhängige Firmen, in denen Musikbegeisterte mit Idealismus arbeiten, Firmen, in denen nach Kriterien der Kunst entschieden wird und erst in zweiter Linie nach dem Umsatz gefragt wird, eine Vielfalt erhalten können. Die soziale Lage der Musiker wird das allerdings nicht unbedingt verbessern. Musiker sind meistens nicht besonders geschäftstüchtig und lassen sich vom Indie genauso bescheißen wie vom Major. Wobei es unter Umständen einfacher sein kann, gegen die Rechtsabteilung eines Konzerns vorzugehen, als mit dem Chef der Indiefirma, dem Kumpel mit dem man auch zu Konzerten und saufen geht, Finanzielles zu besprechen.
Trotzdem: "Das Geschäft mit der Musik" ist ein faktenreiches und wichtiges Buch. Denn, um den Autor noch einmal zu zitieren: "In einer Zeit, in der das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe weltweit durch multinationale Konzerne massiv gefährdet ist, kommt es mehr denn je darauf an, Haltung zu zeigen."

