Erstellt am: 13. 7. 2013 - 06:23 Uhr
Wir sind hier nicht zum Spaß
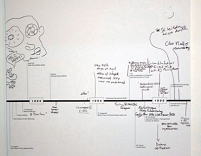
Radio FM4
Vor einigen Monaten berichteten wir an dieser Stelle bereits über das Westberlin- Revival. Aber die Zeit schreitet voran und in Berlin ist man inzwischen schon voll bei der endgültigen medialen und künstlerischen Aufarbeitung der wilden Neunziger Jahre angekommen. Jener mystischen Zeit nach dem Mauerfall also, in der das Berlin von heute entstanden ist, und leider auch der Ruf als Kunst- und Partystadt in die Welt hinaus getragen wurde.
Die Vorgeschichte wurde schon oft erzählt: Der Fall der Mauer ließ ungeahnte Möglichkeiten entstehen und in dieser zeitgeschichtlich einmaligen Situation, in der nicht nur viele Bürger, sondern auch Behörden und Institutionen die Stadt verließen oder sich auflösten, gab es leer stehende Wohnungen en masse, verlassene Ladenlokale, verwaiste Postgebäude und Behördenkantinen, die zu Clubs und Bars umfunktioniert wurden oder deren kulturelle Zwischennutzung man beim zuständigen Bezirksamt beantragen konnte.
Durch diese Freiräume angelockt, stießen vor allem junge Künstler aus dem Westen der Stadt und dann aus der ganzen Welt nach Mitte und Prenzlauer Berg vor und nahmen die ruinöse Stadtviertel in Besitz. Dabei entstanden heute legendäre Orte wie die "galerie berlintokyo", der "Eimer", das "Elektro", der "Friseur", um nur einige zu nennen.

Radio FM4
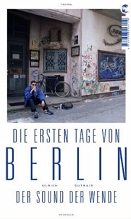
Die ersten Tage von Berlin
Was damals entstand, definiert man heute als "Schnittstelle zwischen Musik und Kunst, Party und Kultur" und stellt verwundert fest, dass damals alles ganz ohne Gewerbeanmeldung, Steuernummer, Social Media, Werbung und Gewinnabsicht passieren konnte. Das Lebensgefühl der wilden Neunziger basierte eben auf ständiger Improvisation, auf der Neugier auf das Anderssein der Anderen, dem Ausprobieren von kollektiven Arbeitspraktiken und Organisationsformen, der Verweigerung der Vermarktbarkeit. "Eine Mischung aus Leben und Kunst, sozialer Plastik, Subkultur und Szenetreff" nennen es Ausstellungsmacher im Jahr 2013 und wollten nun im Kreuzberger Kunsthaus mit der Schau "Wir sind hier nicht zum Spaß" gerade dieses Lebensgefühl des Vorläufigen und Improvisierten festhalten, dabei einige Ansätze der Zeit verbinden und "in einen größeren urbanistischen Kontext setzen".
Das Ergebnis ist leider enttäuschend: Das pralle, aufregende Berlin der Neunziger hat man versucht mit einer recht mageren Austellung zu vermitteln. Ein paar Fotos und Filme werden gezeigt, alberne Exponate - eine Tattoonadel und ein Pflasterstein - geben Rätsel auf. Wäre man damals nicht dabei gewesen, würde man angesichts dieser tristen Präsentation vermuten, dass die Neunziger in Berlin eine arg langweilige, prätentiöse Zeit waren. Am Interessantesten ist noch die Soundinstallation: Ein Hörstück, das aus Interviews mit 30 in dieser Zeit aktiv involvierten Künstlern, Galerie-, Club- und BarbetreiberInnen zusammengesetzt ist. Dieses Sprechstück wird zusammen mit zwei Videoprojektionen von Fotos und kurzen Auszügen aus Filmen verbunden. Die Passagen des insgesamt eineinhalbstündigen Hörstücks wurden von vier Sprechern aufgenommen.

galerieberlintokyo
Weil die Aufarbeitung der Neunziger erst begonnen hat, werden im Rahmen der Ausstellung auch zwei Publikationen zur Zeit vorgestellt: "Galerie Berlintokyo" von Martin Eberle, ein Fotoband, und "Die ersten Tage von Berlin" von Ulrich Gutmair. Wer wirklich etwas über die Neunziger in Berlin erfahren will, sollte sich diese beiden Büchern anschauen. In "Die ersten Tage von Berlin" erzählt der Journalist Ulrich Gutmair die Geschichte der ersten Clubs und Galerien in Mitte nach dem Mauerfall, ordnet seine Erinnerungen aber auch in die politische und gesellschaftliche Geschichte der Stadt ein und lässt neben den ClubpionierInnen und anderen Szeneveteranen der Zeit auch KioskbesitzerInnen aus der heute vollkommen touristifizierten Oranienburger Straße und Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft Mitte zu Wort kommen.

