Erstellt am: 20. 2. 2013 - 23:12 Uhr
Songs for Insane Times
Wie wir heute (Mittwoch) erfahren haben, ist Kevin Ayers am Montag 68-jährig in seiner Wahlheimat, einem kleinen südfranzösischen Dorf, friedlich im Schlaf gestorben. Für alle, die ihn vor fünf, sechs Jahren rund um die Zeit seines kurzlebigen Comebacks in Form des Albums „Unfairground“ gesehen haben, kann das nicht vollkommen überraschend gekommen sein.
Ich traf ihn damals bei einem Gedenkabend für seinen kurz davor verstorbenen Kollegen Syd Barrett im Londoner Barbican. Bernard MacMahon von Lo-Max Records, der gemeinsam mit Ayers' Nachbarn und Freund Tim Shephard den Veteranen der sogenannten Canterbury Scene (mehr dazu im folgenden Text) aus der Versenkung geholt und erfolgreich mit Leuten wie Belle and Sebastian, Teenage Fanclub und The Ladybug Transistor zusammengesteckt hatte, versuchte sein Bestes, mir Kevin vors Mikrophon zu holen. Auch für der Körpersprache mäßig Mächtige war klar zu sehen, dass der erstens keine Lust hatte und zweitens eindeutig zu besoffen dafür war, aber Bernard ist ein sehr hartnäckiger Mensch.
Mein „Interview“ in einer Bar nahe dem Barbican war das reinste Desaster. Was immer ich fragte, sagte, mutmaßte, ich stieß an eine undurchdringliche Wand des Schweigens. Ayers hätte seine Verachtung für mich auch nicht klarer zum Ausdruck bringen können, wenn er mir seinen blanken Progressive-Rock-Popo hingehalten hätte.
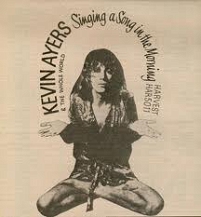
Harvest
Ein paar Tage später fand ich mich in Tim Shepards Wohnung in Notting Hill ein, wo Bernard und Tim eine möglichst heimelige Stimmung für Kevin erzeugt hatten, um ihn meinesgleichen zuliebe gesprächig zu machen. Auch dieses Interview glich einer besonders schmerzhaften Zahnextraktion, hin und wieder unterbrochen von Ayers' Klagen über rasendes Rückenweh.
Ich will es ehrlich sagen: Er war kein geborener Sympathieträger, vielmehr ein auch in der Obskurität einigermaßen arrogant gebliebenes Relikt aus einer Zeit, da sich ein Rockmusiker mit künstlerischem Anspruch (man sagte auch ganz unironisch „Avantgarde“ dazu) für ein paar goldene Jahre die Patronanz einer im Geld schwimmenden Musikindustrie erwarten durfte.
Einer, der nach Frankreich gezogen war, weil es dort den besseren Wein gab, und nach dem Ende der goldenen Jahre die Musik bleiben und den Wein gewinnen hatte lassen.
In anderen Worten: Mein Held, trotz all des Alkohols und all der Jahre übrigens immer noch ein schöner Mann, enttäuschte mich nicht. Ein Kevin Ayers gebrochen durch relativierende historische Perspektive wäre weit weniger spannend gewesen.
Und als ich unser stockendes Gespräch dann runtergetippt hatte, wurde mir klar, dass er wesentlich mehr gesagt hatte, als mir in meinem Unwohlsein in der Gegenwart dieses Griesgrams aufgefallen war. Vor allem in Bezug auf seine Enttäuschung über seine eigene Generation.
Ich habe dieses Interview nun heute auf der alten Website des Schweizer Online-Feuilletons The Title wiedergefunden. Hier ist das Original, und im Folgenden die Abschrift.
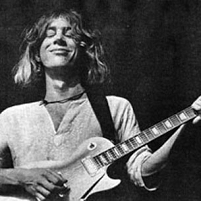
Harvest
Kevin Ayers, auf Ihrem neuen Album «The Unfairground» findet sich eine Nummer namens «Brainstorm», in der Sie zornig singen: «Und du schreist und du brüllst: Gebt mir meinen Traum zurück!» Ist das autobiographisch?
Alles ist autobiographisch, aber ich versuche immer Dinge zu schreiben, mit denen auch andere Menschen etwas anfangen können. Diese Zeile erklärt sich ohnehin von selbst, oder? Jeder braucht einen Traum, um einen Grund zu haben, am Morgen aufzustehen. Warum soll er sonst aus dem Bett? Das ist die Grundfrage, um die es in diesem Album geht. Aber es ist eine Abstraktion dieses Gefühls, weil es nichts Langweiligeres gibt, als wenn einer darüber singt, wie leid er sich selbst tut und dass man gefälligst mit ihm mitfühlen soll.
Ihr Freund und Manager Tim Shepard, der Sie zu Ihrer neuen Platte überredet hat, hat mir erzählt, er habe Sie nur zufällig kennengelernt, weil er Ihnen im französischen Dorf, in dem Sie wohnen, bei einer Vernissage über den Weg gelaufen ist. Er wusste nicht einmal, wer Sie sind.
Ja, aber das ist die Geschichte meines Lebens. So passiert alles bei mir.
Hatte die Tatsache, dass Sie ihm schließlich Ihre Demos anvertraut haben, damit zu tun, dass er nicht Teil des Musikbusiness ist?
Wahrscheinlich schon. Ich habe vor allem schlechte Erfahrungen mit Leuten im Musikbusiness gemacht, da ist viel Misstrauen vorhanden. Tim dagegen fiel gewissermaßen von einem Baum herab.
Als das Projekt ins Rollen kam, reisten Sie gemeinsam nach New York, um mit The Ladybug Transistor zusammen zu treffen. Er sagt, Sie hätten darauf bestanden, ein Zimmer im Chelsea Hotel zu beziehen, weil es Sie an jene Zeit erinnert, als Sie mit Soft Machine in Amerika waren.
Ja, das war das einzige, was ich von ihm verlangte. Zwei Nächte im Chelsea Hotel. Weil ich mich daran erinnerte, dass wir eine wunderbare Zeit hatten, als wir mit Hendrix dort waren. Das machte mich nostalgisch, obwohl dieses Hotel ein ziemliches Drecksloch ist.
War es das nicht immer schon?
Ja, wahrscheinlich schon, aber die Wahrnehmung ändert sich mit den Jahren.
Diese Tour war für Sie damals aber doch sehr traumatisch, schließlich haben Sie danach die Band verlassen. Sie sind in Malaysia aufgewachsen, dann kam die Schule in Kent, eine Zeit in London und schon ging es weiter in die USA. War das alles einfach zu viel in zu kurzer Zeit?
Ja. Als ich zum ersten Mal in England ankam, steckten sie mich in ein Internat, ein privates Gefangenenlager. Ich war heimatlos. Für mich gab es keinen Platz in der britischen Gesellschaft, ich war dort nicht aufgewachsen. Ich ging zum Arbeitsamt, und die wollten mich zur Armee schicken: «Offizierstraining für Sie!»
Großartig. Das hab ich nicht gemacht. Stattdessen habe ich mich mit diesen Leuten getroffen, die ich interessanter fand.
Ich nehme an, als Langhaariger hatte man es im provinziellen Kent damals nicht so leicht.
Stimmt. Und meine Art zu sprechen spielte auch eine Rolle. Ich wurde zweimal zusammengeschlagen, weil mein Akzent «zu vornehm» war. Aber das war nicht meine Schuld.
Diese Leute, die Sie interessanter fanden, waren bekannt als sogenannte Canterbury Scene, die sich im Haus der Eltern von Robert Wyatt traf?
Man muss sich das wie eine Art Club vorstellen. Das waren Leute, die gerne Bücher lasen, Jazz und klassische Musik oder überhaupt jegliche Art von Musik hörten, die wir in die Finger kriegen konnten. Wenn man irgendwie in die Richtung drauf war, tendierte man automatisch zu dieser Gruppe von Leuten, statt zu den anderen, die einen zusammenschlugen oder nur über Fußball und Bier reden wollten.
Die Bezeichnung Canterbury Scene funktioniert ja schon deshalb nicht ganz, weil die Gigs vor allem in London stattfanden.
Abgesehen von der frühen Inkarnation als The Wilde Flowers, in der sich Teile all der Bands
trafen, die später als Canterbury Scene bezeichnet wurden. All das war aber keineswegs so einflussreich wie etwa die Szene in Liverpool. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich glaube nicht, dass es je so etwas wie eine Canterbury Scene gab. Da waren nur ein paar Mittelklassekids, die aus der Schule kamen und eine andere Herkunft hatten, als man sie für gewöhnlich mit Rock’n’Roll assoziieren würde. Sie waren alle belesene und ziemlich gebildete Kinder der Mittelschicht. Es ergab sich einfach. Niemand sagte: Ich will ein Rock’n’Roll-Star werden. Es wuchs einfach.
Aber als Soft Machine im U.F.O.-Club von Joe Boyd und John «Hoppy» Hopkins in London spielten, waren Sie sehr wohl Teil einer Szene.
Oh ja. Das war aber nur zum Arbeiten.
Wirklich? War es nicht auch eine Art magische Familie?
Ja, genau das. Es war viel besser, als in einem Büro zu arbeiten. Soft Machine waren die einzige Familie, die ich je wirklich hatte. Wir machten diese Band, weil wir sonst nirgendwo hin konnten. Wir mussten irgendwie unseren Lebensunterhalt bestreiten. Wir konnten keine normalen Jobs ausüben, und auf der Straße betteln wollten wir auch nicht. Was sollten wir sonst tun? Es gab nicht viel Auswahl. Das ist so, wie wenn sie einem bei Ryanair sagen: "Danke, dass Sie Ryanair gewählt haben." Als gäbe es eine andere Wahl! Aber die Billigflüge haben es mir immerhin ermöglicht, im Ausland zu wohnen und gleichzeitig meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Andernfalls wäre mein Leben undenkbar. Also sitzt man mit eingezogenen Knien im Flugzeug, trinkt den sehr schlechten Wein, den sie einem verkaufen, und leidet still vor sich hin.
Sie sagten vorhin, dass Sie in Großbritannien keine Wurzeln hatten. Haben Sie sich in Malaysia mehr zu Hause gefühlt?
Ja, das war meine Heimat. Und von dort in ein englisches Internat geworfen zu werden, war wie ein Fall vom Himmel in die Hölle. Ich hatte in Malaysia nichts mit den weißen Kindern zu tun gehabt. Ich hatte nur mit den Einheimischen gespielt. Ich sprach fließend Malaiisch, ein bisschen Chinesisch und Indisch, das meiste davon hab ich schon vergessen. Ich wurde auch in der Schule in Malaiisch unterrichtet. Ich lernte malaiische Geschichte und den Koran.
Hat dies auch Ihre Texte und Ihre Musik beeinflusst?
Musik bekam ich als Kind nicht bewusst mit. Das war bloß etwas, das die ganze Zeit rund um mich passierte. Egal, ob es nun eine Hochzeit gab oder Wayang Kulit, dieses Schattenmarionettentheater. Da gab es Gongs und diese Bambus-Xylophone, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass mich das sehr beeinflusst hätte. Das, was ich davon tatsächlich fürs Leben mitgenommen habe, ist eine weniger engstirnige Sicht des Lebens. Diese Leute hatten so eine offene Einstellung zum Sex und dazu, die Dinge leicht zu nehmen. Deshalb hab ich seit 30 Jahren immer in mediterranen Gebieten gelebt und nicht in England. Weil es der Welt meiner Kindheit noch am nächsten kommt, ohne dass ich 2000 Pfund für ein Flugticket zahlen muss. Vor allem Nordafrika, das ich wirklich liebe, fühlt sich für mich immer wie eine Heimkehr an.
Vergangenen Mai sind Sie in London bei einem Tribute-Konzert zum Gedenken an Syd Barrett aufgetreten. War sein Tod ein schmerzlicher Verlust für Sie?
Wahrscheinlich ist es eine gute Sache, dass er gestorben ist. Er war schon vor langer Zeit gestorben. Er verlor so schnell den Boden unter den Füßen, es war beängstigend.
Es gab damals einen Plan, dass Sie mit ihm zusammenarbeiten würden.
Ja, ich ging ihn deshalb auch besuchen. Aber er war in seinem Kopf schon ganz woanders. Ich kannte ihn nicht gut genug, um etwas Intelligentes über ihn sagen zu können, außer dass mir seine ursprünglichen Songs viel bedeuteten. Ich schrieb einen Song über ihn («Oh Wot A Dream» von «Bananamour», 1973, Anm. des Autors). Wie viel mehr kann man über eine Person sagen? Ich kannte den Typen nicht einmal. Ich liebte ja auch das Zeug von Bob Dylan und vielen anderen Leuten, aber ich hatte nie auch nur das geringste Bedürfnis, diese Leute zu treffen. Ihr Output hat mir schon gereicht. Wenn man diese Leute trifft, lernt man doch nur jemand kennen, der genauso abgefuckt ist wie man selbst.
Wie war es dann für Sie, als Sie bei den Aufnahmen für Ihre neue Platte all diese Bands getroffen haben, die ganz glänzende Augen hatten, weil sie mit Ihnen Musik machen durften? Hatten Sie zuvor schon von Teenage Fanclub, The Ladybug Transistor oder Euros Childs gehört?
Nein, ich höre mir überhaupt nicht mehr an, was in der Musik los ist. Aber ich habe gute Leute kennen gelernt, die sehr lebendig sind, einfühlsam und neugierig, und das ist alles, was zählt. Aber es ist schade, dass ihre Musik heute nicht den gleichen Stellenwert hat wie in den Sechzigern und Siebzigern, als die Musiker gewissermassen die Marschkapelle für die Truppen waren. Sie lieferten die Musik, und sie formulierten die Fragen, die die Leute sich selbst stellten: Wozu brauchen wir schon wieder einen dummen Krieg? Warum sollen wir tun, was die Eltern und die Regierung uns sagen? Solche Dinge passieren wohl immer noch, aber sie machen nicht den gleichen Eindruck, weil sie jetzt schon abgedroschen wirken, während sie damals noch außergewöhnlich waren.
Aber Sie haben in den Leuten, mit denen Sie die Platte aufgenommen haben, denselben kritischen Geist wieder erkannt?
Oh ja, man kann das immer noch daran erkennen, was sie sagen. Mein Punkt ist, dass sie nicht die gleichen Chancen kriegen wie wir damals in den Sechzigern und Siebzigern. Wenn man damals was gemacht hat, war es neu, und die Leute sahen sich aktiv danach um. Sie waren auf der Suche und bereit, sich ermutigen zu lassen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass die jungen Menschen sich gegen die bestimmenden Mächte auflehnten und forderten, dass sich die Dinge ändern. Heute geht es mehr darum, sich einlullen zu lassen, und alle stehen unter der Knute ihres Lebensstils, ihrer Pensionsvorsorge und ihrer Hypotheken. Man muss ihnen nur ganz diskret vermitteln, dass sie keinen Ärger machen sollen, weil sie sonst ihr Haus verlieren könnten, und schon geben sie klein bei.
Sind Sie dann nicht zornig über das Verhalten jener Leute, die Sie vorhin als «die Truppen» bezeichnet haben? Schließlich hat diese Generation seither auch ihr Vermögen gemacht und sitzt jetzt selbstzufrieden auf ihren Pfründen.
Das stimmt, viele von ihnen wurden selbst genauso wie das System, das Establishment. Ja, ich bin zornig auf sie. Vor allem, wenn sie prätentiös und heuchlerisch sind. Ich habe viele Exemplare davon in der Musikindustrie kennen gelernt. Sie wedeln eine Fahne mit der Linken und eine andere mit der rechten Hand.
Ihr Ex-Bandkollege Robert Wyatt ist auch immer noch sehr zornig.
Ja. Robert war immer schon viel politischer und exakter, was konkrete Dinge anbelangte.
Und das war auch der letzte Satz, den Kevin Ayers sagte. Dann stöhnte er irgendwas wie "Genügt das jetzt?" und wandte sich wieder seinen Rückenschmerzen zu. Die ist er jetzt zumindest los. Hoffentlich ist der Wein da drüben brauchbar.
Uns bleibt sein Katalog unglaublicher Platten, von denen zumindest die ersten sechs Soloalben und die erste Soft Machine ungeschaut gehört und gekauft werden wollen. Nur halt nicht bei Amazon.

