Erstellt am: 9. 9. 2010 - 16:02 Uhr
Nicht Fisch, nicht Fleisch...
FM4 Schwerpunkt zum Thema "Tiere essen" am Freitag, 9. September 2010
- Nicht Fisch, nicht Fleisch - "Tiere essen" von Jonathan Safran Foer
- "Es kommt auf das Management an." - Christoph Winckler, Leiter des Instituts für Nutztierwissenschaften an der Wiener BOKU, im Interview.
- Das Schnitzel zum Streicheln - Ein Schokoladenhersteller verwirklicht seine Vision vom "Essbaren Tiergarten"
Die erfolgreichste Fastfood-Kette der Welt setzt den Veggie Burger wieder auf ihre Speisekarte, und bewirbt ihn in TV-Spots. Tofu ist aus den Reformhäusern in die Regale gewöhnlicher Supermärkte gewandert, und liegt dort als praktisches Fertigprodukt bereit.
Das ist keine Revolution, aber steht sinnbildlich für den Imagewechsel, den der Vegetarismus in der öffentlichen Wahrnehmung endlich vollzogen hat, und für ein damit einhergehendes Lifestyle-Phänomen:
Fleischlos ist das neue bio. Und wer es darauf anlegt, das richtige Leben im Falschen zu führen, verzichtet auf seine wöchentliche Fleischration und gestattet der Freitagsscholle, sich künftig nur mehr vom Sand am Meeresboden panieren zu lassen.
Vegetarierpapst
Als "Galionsfigur der aufgeklärten Besseresser" ist Jonathan Safran Foer in den letzten Wochen und Monaten durch die internationalen Medien gereicht worden. Sein letztes Buch "Tiere essen" gilt als "neue Vegetarierbibel" und hat eine Debatte entzündet, die der westlichen Welt kontroverse, betroffene und angewiderte Tischgespräche serviert.
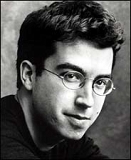
Marion Ettlinger
Begonnen hat alles kurz bevor Foer Vater wurde. Die zunächst simpel anmutende Frage "Was soll ich meinem Kind zu essen geben?" zieht eine Reihe von weiteren Fragen nach sich: Wären Hamburger, Fischstäbchen und Steak vertretbar? Woher kommt das Fleisch in den Supermärkten? Wie werden die Tiere in Massentierhaltung und Schlachthöfen behandelt?
Und welche ökologischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen hat unser aller Fleischkonsum?
In den folgenden drei Jahren ackert sich Foer durch die relevante wissenschaftliche Literatur, steigt heimlich in eine kalifornische Hühnerfarm ein, und spricht mit SchlachthofmitarbeiterInnen, FleischproduzentInnen und TierrechtsaktivistInnen.
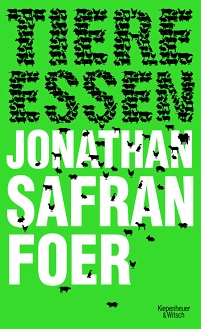
Verlag Kiepenheuer & Witsch
Seine Ergebnisse sind so ernüchternd wie vorhersehbar:
Nichts, was wir tun, kann unmittelbar soviel Leid bei Tieren verursachen wie das Fleischessen, und keine unserer täglichen Entscheidungen hat größere Folgen für die Umwelt.
Die Haltung von Nutztieren trägt mehr zur globalen Erwärmung bei als alle Autos, LKWs, Flugzeuge, Schiffe und Züge zusammen. Ihre Exkremente verschmutzen Böden und Gewässer. Für ihr Futter werden Wälder gerodet. Antibiotika "verhelfen" ihren genmanipulierten Körpern gerade noch bis zum Schlachttermin. Sobald sie verzehrt sind, machen sie uns fett und krank.
Die Masse der Fakten, mit der uns Foer den Appetit verdirbt, ist überwältigend. Darstellungen von lebendig zerteilten Rindern, kannibalistischen Schweinen oder Puten, deren Muskel- und Fettgewebe schneller wächst als deren Knochen, liegen einem/r buchstäblich im Magen.
Glückliches Schnitzel?
Jede/r ÖsterreicherIn isst durchschnittlich 66,4 kg Fleisch im Jahr. 40 kg davon sind Schweinefleisch, 14 kg Rind- und Kalbfleisch. Die restlichen 12,4 kg entfallen auf Geflügel, Lamm und andere Fleischsorten.
Als österreichische/r KonsumentIn mag man derartige Fehlentwicklungen zunächst vielleicht nur in der US-amerikanischen Fleischindustrie vermuten. Doch mit ein wenig Internetrecherche schwindet schnell auch das Vertrauen in europäische und österreichische Standards.
Die Bedingungen hierzulande sind längst nicht so vorbildlich, wie es oft scheint.
Das österreichische Tierschutzgesetz erlaubt z.B. Mastrinder und -schweine ein Leben lang auf Vollspaltenböden zu halten, was regelmäßig zu Verletzungen, Infektionen und Verhaltensstörungen führt. Ferkel dürfen ohne Betäubung kastriert werden, und Küken kürzt man bei vollem Bewusstsein die Schnäbel.
Auch die Platzverhältnisse sind gering bemessen: Ein 110 Kilogramm schweres Mastschwein muss schlimmstenfalls mit 0,7 Quadratmeter Stallfläche auskommen, Mastrinder je nach Gewicht mit 2-3 Quadratmeter und in der konventionellen Hühnermast sind 30 Kilogramm Huhn pro Quadratmeter erlaubt. Bei Vollbesetzung ist daher der Platz, den jedes Tier zur Verfügung hat, etwas kleiner als ein Din-A4-Blatt.
Auslauf ins Freie ist für die Vögel übrigens nicht zwingend vorgeschrieben. Und selbst bei Bio-Kühen geht mitunter eine abgezäunte Betonfläche als Auslauf durch.
Weitere Bücher zum Thema
- Martin Schlatzer: Tierproduktion und Klimawandel
- Thilo Bode: Die Essensfälscher
- Hans Weiss: Schwarzbuch Landwirtschaft
Aus all diesen Gründen widmen wir uns in FM4-Connected am Freitag, 10.9., ganz dem Thema „Tiere essen“.
- In der On Air-Buchbesprechung kommt Jonathan Safran Foer selbst zu Wort.
- Elisabeth Semrad besucht Josef Zotter in seinem gerade entstehenden "Essbaren Tiergarten" und spricht mit ihm darüber, wie es ist, seine eigene Kuh am Teller zu haben.
- Und Prof. Christoph Winckler vom BOKU-Institut für Nutztierwissenschaften erzählt mehr über die Nutztierhaltung in Österreich.


