Erstellt am: 10. 8. 2010 - 12:21 Uhr
"Done"
von Elisabeth Semrad
Vor 20 Jahren, am 10. August 1990, wurde Österreich via Standleitung über TCP/IP erstmals permanent mit dem weltweiten Netz verbunden. Bis dahin mussten jedoch einige Hürden überwunden werden. Die Internetpioniere Peter Rastl und Hermann Steinringer erinnern sich an die Anfänge im Rechenzentrum der Uni Wien und an ihre ersten Erfahrungen mit dem damaligen Wächter der Telefonleitungen, der österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung.
Dem "Internet" in Österreich einen Geburtstag zu geben, ist nicht so leicht. Allerdings hat man sich auf Bestreben von Peter Rastl auf den 20. August 1990 geeinigt. Er muss es wissen, gilt er immerhin als Geburtshelfer und Vater des österreichischen Internet. Als damaliger Leiter des Zentralen Informatikdienstes der Universität Wien setzte sich der promovierte Chemiker schon früh in den 80er Jahren für eine Vernetzung von Computern ein. Und das, obwohl er Ende der siebziger Jahre von Emails noch so gut wie gar nichts gehalten hat. "Die Vorstellung, dass man am Computer Briefe verschickt, ist mir als so unsinnige Geldverschwendung vorgekommen. Da verwendet man diese millionenteure Maschinen, um so läppische Sachen wie Brieferlschreiben zu machen."
"Vienna is up and Running". Mit diesem Satz wurde am 10. August 1990 am Rechenzentrum der Universität Wien das weltweite Netz zugänglich.
Elektronische Post konnte man in Österreich schon vor 1990 senden und empfangen. So war es auch möglich, sich über Einwahlverbindungen kurz ins Internet einzuloggen. Eine permanente Verbindung bestand bislang aber nicht. Erst am 10. August 1990 wurde eine fixe Standleitung von der Uni Wien zum Genfer Kernforschungsinsitut CERN auf das Internet-Protokoll TCP/IP umgestellt und Österreich somit erstmals mit dem amerikanischen Netz verbunden.
Die Riesenmaschine IBM 3090-VF
Möglich machte das eine Großrechenanlage des Büromaschinenherstellers IBM an der Uni Wien. Installiert wurde der so genannte Supercomputer IBM 3090-VF von dem Nachrichtentechniker Hermann Steinringer, der seinerzeit im Rechenzentrum für "Datenfernverarbeitung" verantwortlich war. "Das Ding hat insgesamt 16 Tonnen gewogen, und als diese Riesenmaschine durch die Gänge und über die Treppen des Neuen Institutsgebäude gehievt wurde, das war schon spannend." Auch Peter Rastl erinnert sich zurück an die Zeit der schweren Großrechner: "Das war eine Riesenmaschine, die irrsinnig viel gekostet hat, etwa 100 Millionen Schilling. Sie hat einen ganzen größeren Raum gefüllt und wurde klimatisiert mit Kühlwasser, das extra aufbereitet werden musste."
Die Supercomputer Initiative von IBM

Günther Hack
Ende der 80er Jahre installierte der Büromaschinenhersteller IBM im Rahmen seiner "European Supercomputer Initiative" vier Supercomputer, genannt "IBM 3090 VF", in Forschungseinrichtungen in Montpellier, Hamburg, Genf und Wien. Per Datenleitung wurden die vier Maschinen miteinander verbunden. Peter Rastl setzte sich für eine Verbindung zum Genfer Kernforschungsinstitut CERN ein, da dieses über eine transatlantische Datenleitung mit dem amerikanischen Netz verbunden war.
1989 wurde das Projekt "Internet" von der Telegraphenverwaltung genehmigt. Im Februar 1990 ging die Leitung "Geneve-Wien NP1" schließlich in Betrieb. Kommuniziert wurde derweil via IBM-Standard-Protokoll "SNA".
Hermann Steinringer, Nachrichtentechniker und seinerzeit im Rechenzentrum für "Datenfernverarbeitung" verantwortlich, schlug vor, auf das in den USA gebräuchliche Protokoll "TCP/IP" umzustellen, auf dem das heutige World Wide Web basiert. "Mir gefiel das amerikanische System besser, es gab weniger Regeln und ließ sich leichter implementieren."
So groß die Maschinen auch waren, die Verbindungsgeschwindigkeit selbst würde uns heute wahnsinnig werden lassen. Peter Rastl: "Es war eine der ersten transatlantischen Glasfaserleitungen mit der damals sagenhaft großen Geschwindigkeit von 1,54 Megabit pro Sekunde. Heute lacht man darüber, denn 2 Megabit sind so gut wie nichts. Aber damals war das eine riesige Bandbreite. Über das ist der ganze Kontinent Europa an die USA angeschlossen worden."
Unspektakuläre Geburt
Heute füllen die Geschichten über diesen denkwürdigen Freitagabend in einem Keller der Uni Wien die IT-Spalten der Zeitungen und Rundfunkstationen. Damals hat sich kein einziges Medium dafür interessiert. Auch die Entwickler selbst waren sich der Bedeutung nicht bewusst: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sehr aufgeregt gewesen wäre. Wir haben zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung gehabt, welche Bedeutung das Internet bekommen würde", erklärt Rastl. Aus diesem Grund gibt es auch keine Fotos. Für die Wissenschafter war das Internet anfangs kein Massenmedium, sondern ein praktisches Forschungs-Werkzeug und eine nette Spielerei. Von einer wirtschaftlichen oder gar gesellschaftlichen Bedeutung war damals überhaupt nicht die Rede.

Günther Hack
Schon vor 1990 hatte man Zugriff auf das Internet. Allerdings nur via Einwahlverbindungen. Eine permanente Verbindung bestand bislang aber nicht. Erst am 10. August 1990 wurde die jetzt medial in den Adelsstand erhobene fixe Standleitung von der Uni Wien zum Genfer Kernforschungsinsitut CERN auf das Internet-Protokoll TCP/IP umgestellt und Österreich somit erstmals mit dem amerikanischen Netz verbunden.
Protocol Wars und Normenschlachten
Internationale Programmiersprachen und grenzenüberschreitende Standards waren vor 20 Jahren ebenfalls noch eine Zukunftsvision. Ende der 80er Jahre herrschten die so gennanten Protocol Wars, Protokollkriege zwischen den USA und Europa. In Europa war man darauf bedacht, etwas zu schaffen, das besser war als das Internet in den USA, wie Hermann Steinringer weiß: "In Europa meinte man, man müsse der amerikanischen Telekommunikationsindustrie etwas entgegensetzen. Typisch europäisch: fürchterlich aufgeblasen mit fürchterlich vielen Protokollen und Normen." In Europa hielt man herzlich wenig von den von der Internetgemeinde selbst geschriebenen technischen Normen und hielt verbissen an den eigenen Normen fest. "Man glaubte, wenn die Leute wie in den USA das selbst machen, kann das nichts Ordentliches sein. Man verlangte nach Normen, wie man es in der Telefonie gewohnt war," sagt Peter Rastl "Die EU hat das gepusht, um die europäische Kommunikationsindustrie zu begünstigen. Weil dieser Prozess aber viel zu langsam von statten ging, hat man in Europa politisch den Anschluss an die Internetentwicklung verpasst."
".at" – Österreich bekommt eine Domain
Bereits zwei Jahre zuvor, im Januar 1988, hatte Peter Rastl die Top-Level-Domain ".at" für Österreich beantragt. "Ein Kollege von mir schrieb eine Mail an Jon Postel, einen amerikanischer Guru, der Internetadressen verwaltet und vergeben hat, sozusagen als One-Man-Show. Dem schrieben wir eine Mail, er möge doch bitte Österreich eintragen. Er schrieb zurück "Done", also "erledigt". Völlig unspektakulär." Anschließend etablierten die Techniker Subdomains, sprich "ac.at" für den akademischen, "gv.at" für den Government-, "co.at" für den kommerziellen und "or.at" für alle sonstigen Bereiche. "Diese Subdomains einzuführen war eine Entscheidung, die ich aus heutiger Sicht nicht mehr als so clever erachte", gesteht Peter Rastl. "Auf die Idee, dass je Privatpersonen eine Domain besitzen würden, sind wir gar nicht gekommen. Deutlich später haben wir erst den großen Bedarf daran bemerkt. Die Rolle des kommerziellen Internet haben wir damals sicherlich nicht erkannt."

help.gv.at
Telegrafenverwaltung
Nötig war vor allem Überzeugungsarbeit von Seiten der Internetpioniere. Die Post- und Telegraphenverwaltung, die nicht nur ein Staatsbetrieb, sondern zugleich auch Exklusivmonopolist war, wollte ihre Herrschaft über die Telefonleitungen nicht aufgeben und fürchtete Geschäftseinbußen, wie sich Hermann Steinringer erinnert: "Sie war nicht leicht zu überzeugen. Ich habe stets betont, dass wir keine Konkurrenten sind und habe immer wieder gesagt: Wir machen euch kein Geschäft kaputt, im Gegenteil, es könnte ein Geschäft für euch werden." Nach zwei Jahren Überzeugungsarbeit und finanzieller Unterstützung des Bundes hieß es 1990 dann endlich "Vienna is up and running."
Die erste Begegnung mit dem World Wide Web
1992 trafen Peter Rastl und Hermann Steinringer auf einer Tagung in Innsbruck auf Tim Berners Lee, der am Kernforschungsinstitut CERN die Hyper Text Markup Language (HTML) entwickelte und heute oft als der Erfinder des World Wide Web bezeichnet wird. Er referierte damals über sein Konzept zum "World Wide Web". Für Peter Rastl waren es damals sonderbare Ideen, über die er sprach. "Es hat mich damals nicht elektrisiert, was er sagte. Ich habe überhaupt nicht begriffen, dass so etwas eine Zukunft haben würde, dachte mir nur, "so etwas Merkwürdiges" und habe die Idee mehr oder weniger ad acta gelegt. Erst später wurde mir klar, was ich da eigentlich verschlafen habe."
Es dauerte noch einige Zeit, bis man in Österreich World Wide Web Server aufbaute. Erst 1995 ging der Webserver der Uni Wien erstmals in Betrieb. "Es war anfangs schwer, diese mit sinnvollen Inhalten zu füllen. Eine der ersten WWW-Applikationen, an die ich mich erinnern kann, war von einer Uni-Assistentin an der Universität Salzburg, die einen Adventkalender gemacht hat. Wenn man ein Kästchen angeklickt hat, ist eine neue Seite aufgegangen, damit konnte man das Konzept der Hyperlinks demonstrieren. Es ging anfangs lediglich um Spielereien."
Computer Literacy und Digital Divide
Für Peter Rastl ist der Umgang mit dem Internet heute eine Kulturtechnik wie Schreiben, Lesen und Rechnen, die jeder Mensch erlernen sollte. "Der Umgang mit der Kommunikations- und Informationstechnologie, die Computer Literacy, ist von großer Bedeutung. Wer heute mit dem Computer und dem Internet nicht umgehen kann, hat ein großes Defizit. Deshalb ist es wesentlich, dass alle Bereichen in der Gesellschaft damit umzugehen lernen und man den Digital Divide schließt."
Weshalb der Vater des Internets auch dafür plädiert, dass Kinder das Netz möglichst frühzeitig kennenlernen. "So wie man Verkehrserziehung schon im Kindergarten macht, so sollte man Kindern auch den Umgang mit dem Internet beibringen. Vielleicht sollte man ein Facebook mit Stützrädern einführen."
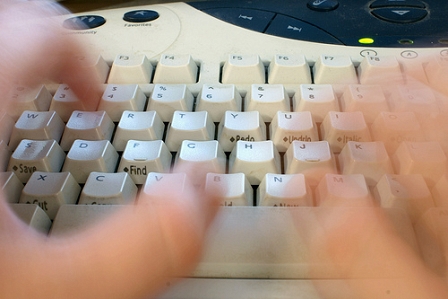
laffy4k/flickr
Entwicklungen hin zur Vorratsspeicherung oder Kinderpornografie-Filtern steht Rastl skeptisch gegenüber. "Seit dem 11. September beginnen die Staaten, das Internet einzuschränken. Man muss mit dem Problem des Terrorismus und der Internetkriminalität umgehen, ohne Kollateralschäden anzurichten, ohne, dass es zu solch einer Erosion des Datenschutzes im Internet kommt, nur weil es technisch möglich ist."
Trotz allem ist Peter Rastl auch regelmäßiger Besucher in Social Networks, besitzt sowohl einen Facebook-, Linked.In - und einen Xing-Account. "Auf Facebook bin ich lediglich, um mir die Urlaubsfotos meiner Tochter anzusehen."
Zuhause ist Peter Rastl übrigens erst seit dem Jahr 2000 online. Die Verbindungen davor waren ihm einfach zu langsam. Aber wer Zugriff zu einem Supercomputer mit 16 Tonnen hat, kann mit begrenztem Downloadvolumen natürlich nicht so gut umgehen.

